Radial(hufen)flur
Durch schematische Neuparzellierungen im Gefolge von Verkoppelungen in Ostholstein und Mecklenburg entstandene Fluren. Dabei reichen die Parzellen fächerförmig von den Gehöften zu den Gemarkungsrändern.
Durch schematische Neuparzellierungen im Gefolge von Verkoppelungen in Ostholstein und Mecklenburg entstandene Fluren. Dabei reichen die Parzellen fächerförmig von den Gehöften zu den Gemarkungsrändern.
Sonderform des Waldhufendorfes, bei dem an Talenden aus der langgestreckten Gehöftreihe eine stark gebogene Gehöftzeile oder sogar ein Angerdorf wurde und keine strenge Parallelität der Streifenparzellierung zu erreichen war. Die Parzellen teilen die Flur vielmehr segmentförmig.
Auch Feldrain, Ackergrenze, Ackerrain; Bezeichnung für die oftmals grasbewachsene Feldgrenze. Man unterscheidet:
Bei der Ausräumung der Kulturlandschaft wurden die Raine großenteils beseitigt, was einen Verlust an morphologischer, biotischer, ökologischer und ästhetischer Vielfalt in der Landschaft bedeutet und eine geringere ökologische Stabilität zur Folge hat.
Betrieb mit extensiver Weidewirtschaft (hauptsächlich Rinder, Schafe auf Dauerweiden) auf natürlichen Futterflächen von zumeist beträchtlicher Größe und mit festen Betriebsgrenzen. Meist wird nur eine Tierart gehalten, wobei wie im Falle australischer Schafhalter noch eine weitere Spezialisierung in Fleisch- und Wollschafhaltung möglich ist. Man wählt i.d.R. anspruchslose Tierrassen, die futterknappe Zeiten gut überstehen, bzw. je nach Rentabilität des Betriebes wird Futter dazugekauft. Die Monostruktur hat ein sehr hohes Produktionsrisiko (naturbedingt wie auch marktbedingt) zur Folge. Die Eigentums- und Nutzungsrechte an Weideflächen und Vieh können sehr unterschiedlich sein (privat, ganz- oder halbstaatlich, genossenschaftlich). Der Begriff wird vor allem in Nordamerika verwendet.
Ranchbetriebe besitzen zwei hervorstechende Eigenschaften: Zum einen ermöglichen sie eine recht gute Arbeitsproduktivität, zum anderen dulden sie eine extrem niedrige Bodenproduktivität, die von keinem anderen Betriebssystem unterschritten wird, mit Ausnahme des Nomadismus.
Viehbesatz, Arbeits- und Kapitaleinsatz sowie Betriebsertrag sind, bezogen auf die Fläche, extrem niedrig. Der Kapitalbedarf für die Einrichtung einer Ranch ist andererseits hoch.
Im Gegensatz zum Nomadismus ist die Ranch eine Betriebsform zur Erschließung siedlungsleerer Savannen und Steppen (Prärie, Llanos, Sertão, Pampa, Chaco, Karoo). So ist Ranchwirtschaft besonders in Südamerika, Australien, den USA, Südafrika und in manchen Staaten Ostafrikas verbreitet.
Moderne Ranches sind heute mit stationärer Infrastruktur ausgestattet und durch Zäune in Kämpe bzw. Koppeln unterteilt, so dass ein geregelter Weideumtrieb erfolgen und der Viehbestand in homogene Gruppen aufgeteilt werden kann. Lokal noch vorhandene Betriebe mit freiem Weidegang innerhalb der Betriebsfläche passen sich verstärkt an heutige Normen an. Dem Vieh stehen ausschließlich oder vorwiegend Naturweiden zur Verfügung. Teilweise erfolgt eine Weideverbesserung durch Aussaat geeigneter Futtergräser. Moderne Verfahren der Tierzucht und Tierpflege (u.a. künstliche Besamung, Veterinärbetreuung) sind üblich.
Die Minimalgröße einer US-amerikanischen Ranch beträgt 500 ha. In den Great Plains und den intramontanen Becken werden über 100.000 ha erreicht, in Argentinien rd. 200.000 ha. Die größten Betriebe liegen in den trockensten Regionen; dort überwiegt meist Schafhaltung, sonst Rinderhaltung.
Es sind zwei Standorttypen, auf denen sich der Ranchbetrieb gegenüber allen anderen Betriebsformen als überlegen erweist: Einmal Standorte mit sehr ungünstigen ökonomischen (unbefriedigende Marktpreise, Marktferne der Ranch) und zum anderen solche mit sehr ungünstigen ökologischen Produktionsbedingungen. Zumeist summieren sich beide Momente.
Eigentümer von Ranches können Privatleute, Familiengruppen, aber auch Kapitalgesellschaften sein. Letztere treten insbesondere in den USA, in Südamerika und in Australien auf. Häufig fließt außerlandwirtschaftliches Kapital als Folge von Steuervergünstigungen in diese Gesellschaften.
In Entwicklungsländern (hohe Agrarquote) zeigen Regionen mit Ranching eine Eigentumsverteilung, insbesondere an Fläche, bei der wenige Eigentümer vielen Landlosen, die im günstigsten Falle in diesen Ranches Arbeit gefunden haben, gegenüber stehen. Es gibt dort nur wenige Zonen, in denen dies nicht zu verteilungspolitischen und sozialen Problemen führt.
Analog zur Übernahme dieser Art der Viehhaltung aus dem mexikanisch-spanischen Raum stammt auch der Name vom spanischen "rancho".
Moderne Form einer extensiven, stationär und kommerziell betriebenen Weidewirtschaft in natürlich entstandenen Offenlandschaften, die von europäischen Siedlern in Amerika (Vermischung der traditionellen anglo-amerikanischen und spanisch-mexikanischen Rinderhaltungsformen in Texas und Louisiana) und Australien entwickelt und von dort in einige Gebiete der Alten Welt (z. B. südliches Afrika) übertragen wurde. Spanische Siedler brachten zu Beginn der Kolonialzeit Rinder und Pferde in die argentinische und uruguayische Pampa und die Gebirgsketten Mexikos, und die Herden dieser Tiere verbreiteten sich rasch in den heutigen Südwesten der Vereinigten Staaten.
Allerdings werden die Wurzeln des Ranching im sommertrockenen Iberien angenommen, wo im Zuge der Reconquista menschenleere, semiaride Räume durch große Herden von Merinoschafen und Rindern unter Aufsicht berittener Hirten genutzt wurden. Dieses Agrarsystem fand mit der spanisch-portugiesischen Eroberung im 16. Jh. Eingang in die menschenleeren Grasländer Amerikas, die Pampas, den Chaco, die Sertãos Brasiliens, die Llanos von Venezuela, die Trockengebiete des nördlichen Mexikos, Kaliforniens und von Texas.
Demnach ist Ranching vor allem in den gemäßigten und subtropischen Kurzgrassteppen Nordamerikas, Südamerikas, Südafrikas, Australiens und Neuseelands verbreitet.
Die Bezeichnung ist abgeleitet von dem Begriff „Ranch“, der im Englischen den Sitz und das Wohnhaus eines Viehzüchters bezeichnet. In Australien und Neuseeland spricht man von „Cattle- oder Sheep-Station“ und in Südamerika von Estancia oder Fazenda.
Ähnlich wie der Nomadismus ist das Ranching unter dem Druck feldbaulicher Interessen immer mehr in Gebiete jenseits der agronomischen Trockengrenze abgedrängt worden. Ranches treten vor allem in den Trockensteppen der Mittelbreiten und der Subtropen sowie den semiariden Savannen auf. Im Gegensatz zum Nomadismus ist das Ranching mit seinen hochspezialisierten Großbetrieben rentabilitäts- und marktorientiert. Die Betriebe waren zeitweise (Beginn des 20. Jh.) sogar vorwiegend auf den Weltmarkt ausgerichtet. Heute ist die weltwirtschaftliche Verflechtung des Ranching deutlich geringer, was u.a. auf den starken Bevölkerungsanstieg und die Verstädterung in den südamerikanischen Ländern sowie den Agrarprotektionismus der Industrieländer zurückzuführen ist.
Auf einer Ranch wird zumeist Rinderproduktion, in sehr trockenen Gebieten auch Schafproduktion betrieben (zum Beispiel Karakulschafe in Namibia). Aufgrund der besseren Anpassung an die ökologischen Gegebenheiten kommt heute teilweise auch Wildtierhaltung vor (zum Beispiel Bison oder Guanako). Die Herden werden von mehr oder weniger halb-sesshaften Viehhirten (je nach Land Cowboys, Stockmen, Vaqueros, Gauchos u. a.) betreut.In den meisten Fällen wird Fleisch und Leder produziert. Zusätzliche Landwirtschaft ist selten.
Ranching ist die hauptsächliche Landnutzungsform in Gebieten, die für den Ackerbau zu trocken sind: wie semiaride Trockensavannen und Steppen jenseits der agronomischen Trockengrenzen. Durch die Niederschlagsarmut ist diese Form der Landwirtschaft an sehr große Flächen gebunden. Die Mindestgröße einer US-amerikanischen Ranch beträgt 500 ha. In den Great Plains und den intramontanen Becken der Rocky Mountains werden über 100.000 ha erreicht, in Patagonien bis zu 200.000 ha, wobei die größten Flächen in den trockensten Regionen liegen. In geringerem Maße ist Ranching in semihumidem bis humidem Grünland wie der Pampa Humeda im südlichen und den Llanos im nördlichen Südamerika sowie in einigen Regionen der Prärie-Staaten der USA verbreitet. Hier findet jedoch zunehmend eine Verdrängung durch die Schaffung neuer Ackerflächen statt.
Weitere Informationen:
Bezeichnung für jedes Grasland, Buschland, Waldflächen, Feuchtgebiete oder Wüstengebiet, das von Nutztieren oder Wildtieren beweidet wird und im Allgemeinen nicht für den Anbau von Nutzpflanzen geeignet ist. Nicht zum Rangeland gehören Wälder ohne beweidbare Untervegetation, karge Wüsten, Ackerland oder Land, das mit festem Gestein, Beton oder Gletschern bedeckt ist.
Rangeland wird weniger intensiv bewirtschaftet als Weideflächen, da es hauptsächlich von einheimischer Vegetation und nicht von vom Menschen angepflanzten Pflanzen dominiert wird und in der Regel keinen landwirtschaftlichen Praktiken wie Bewässerung und Düngemitteleinsatz unterliegt.
Die Bewirtschaftung von Rangeland konzentriert sich auf die Erhaltung der natürlichen Vegetation und die Anpassung an das Klima, beispielsweise durch angepasste Beweidungspraktiken oder kontrollierte Brände.
Rangeland wird auch hauptsächlich mit Methoden wie kontrollierter Viehweidewirtschaft und kontrollierten Bränden bewirtschaftet und nicht mit intensiveren landwirtschaftlichen Methoden wie Aussaat, Bewässerung und Einsatz von Düngemitteln.
Feuer ist auch ein wichtiger Regulator der Vegetation in Weidegebieten, unabhängig davon, ob es von Menschen gelegt wurde oder durch Blitzeinschläge entstanden ist. Brände reduzieren in der Regel die Häufigkeit von Gehölzen und fördern krautige Pflanzen, darunter Gräser, Kräuter und grasähnliche Pflanzen. Die Unterdrückung oder Verringerung regelmäßiger Waldbrände in Wüstengebüschen, Savannen oder Waldgebieten führt häufig dazu, dass Bäume und Sträucher dominieren und Gräser und Kräuter fast vollständig verdrängt werden.
Rangeland bedeckt weltweit etwa 80 Millionen Quadratkilometer, wobei 9,5 Millionen Quadratkilometer geschützt sind und 67 Millionen Quadratkilometer für die Viehzucht genutzt werden. Diese Gebiete ernähren etwa 1 Milliarde Tiere, die von Viehzüchtern in über 100 Ländern gehalten werden, was ihre entscheidende Rolle sowohl für den ökologischen Schutz als auch für die landwirtschaftliche Produktivität verdeutlicht.
Rangeland-Typen
Laut UNCCD sind 35 % der Rangelandflächen Wüsten und xerische Buschlandschaften, 26 % tropische und subtropische Graslandschaften, Savannen und Buschlandschaften, 15 % Tundra, 13 % gemäßigte Graslandschaften, Savannen und Buschlandschaften, 6 % Bergwiesen und Buschland, 4 % mediterrane Wälder, Waldgebiete und Buschland sowie 1 % überschwemmte Wiesen und Savannen.
Prärie
Prärien werden von Ökologen aufgrund ihres ähnlichen gemäßigten Klimas, ihrer moderaten Niederschlagsmenge und ihrer vorherrschenden Vegetation, die eher aus Gräsern, Kräutern und Sträuchern als aus Bäumen besteht, als Teil des Bioms der gemäßigten Graslandschaften, Savannen und Buschlandschaften angesehen. Zu den gemäßigten Graslandregionen gehören die Pampa in Argentinien und die Steppen Eurasiens.
Grasland
Graslandgebiete sind Gebiete, in denen die Vegetation von Gräsern (Poaceae) und anderen krautigen (nicht verholzten) Pflanzen dominiert wird. Es kommen jedoch auch Seggen (Cyperaceae) und Binsen (Juncaceae) vor. Grasland kommt auf allen Kontinenten außer der Antarktis natürlich vor. In gemäßigten Breiten, wie Nordwesteuropa und den Great Plains und Kalifornien in Nordamerika, werden die heimischen Graslandschaften von mehrjährigen Büschelgrasarten dominiert, während in wärmeren Klimazonen einjährige Arten einen größeren Teil der Vegetation ausmachen.
Steppe
In der physischen Geographie bezeichnet Steppe eine Biomregion, die durch Graslandebenen ohne Bäume gekennzeichnet ist, abgesehen von denen in der Nähe von Flüssen und Seen. Die Prärie (insbesondere die Kurzgras- und Mischprärie) ist ein Beispiel für eine Steppe, obwohl sie normalerweise nicht so bezeichnet wird. Je nach Jahreszeit und Breitengrad kann sie halbwüstenartig sein oder mit Gras oder Sträuchern oder beidem bewachsen sein. Der Begriff wird auch verwendet, um das Klima in Regionen zu bezeichnen, die zu trocken sind, um einen Wald zu ernähren, aber nicht trocken genug, um eine Wüste zu sein.
Pampa
Die Pampa ist das fruchtbare Tiefland Südamerikas, das die argentinischen Provinzen Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos und Córdoba, den größten Teil Uruguays und den Bundesstaat Rio Grande do Sul im südlichsten Teil Brasiliens umfasst und sich über mehr als 750.000 km² erstreckt. Das Klima ist mild, mit Niederschlägen von 600 mm bis 1.200 mm, die mehr oder weniger gleichmäßig über das Jahr verteilt sind, wodurch die Böden für die Landwirtschaft geeignet sind.
Buschland
Buschland ist eine Pflanzengemeinschaft, die durch eine Vegetation gekennzeichnet ist, in der Sträucher dominieren, oft auch Gras, Kräuter und Geophyten. Buschland kann entweder natürlich vorkommen oder das Ergebnis menschlicher Aktivitäten sein. Es kann sich um die ausgereifte Vegetationsform einer bestimmten Region handeln, die über einen längeren Zeitraum stabil bleibt, oder um eine Übergangsgemeinschaft, die vorübergehend als Folge einer Störung, wie z. B. einem Brand, entsteht. Ein stabiler Zustand kann durch regelmäßige natürliche Störungen wie Feuer oder Verbiss aufrechterhalten werden. Buschland kann aufgrund der Brandgefahr für menschliche Besiedlung ungeeignet sein.
Waldland
Waldland ist ein Wald mit geringer Dichte, der offene Lebensräume mit viel Sonnenlicht und begrenztem Schatten bildet. Waldland kann ein Unterholz aus Sträuchern und krautigen Pflanzen, einschließlich Gräsern, beherbergen. Waldland kann unter trockeneren Bedingungen oder in frühen Stadien der primären oder sekundären Sukzession einen Übergang zum Buschland bilden. Höhere Dichten und Flächen von Bäumen mit weitgehend geschlossenem Kronendach, die ausgedehnten und nahezu durchgehenden Schatten spenden, werden als Wald bezeichnet.
Savanne
Die Savanne ist ein Grasland-Ökosystem, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die Bäume so klein oder weit auseinander stehen, dass sich das Blätterdach nicht schließt. Das offene Blätterdach lässt ausreichend Licht auf den Boden fallen, um eine ununterbrochene Krautschicht zu bilden, die hauptsächlich aus C4-Gräsern besteht.
Wüste
Eine Wüste ist eine Landschaft oder Region mit extrem geringen Niederschlagsmengen, definiert als Gebiete mit einer durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge von weniger als 250 Millimetern pro Jahr oder als Gebiete, in denen durch Evapotranspiration mehr Wasser verloren geht, als als Niederschlag fällt. Im Klimaklassifizierungssystem nach Köppen werden Wüsten als BWh (heiße Wüste) oder BWk (gemäßigte Wüste) klassifiziert.
Tundra
Die Tundra ist ein Biom, in dem das Baumwachstum durch niedrige Temperaturen und kurze Vegetationsperioden behindert wird. Der Begriff Tundra stammt aus dem Russischen тундра und geht auf das Kildin-Sami-Wort tūndâr „Hochland“, „baumloses Berggebiet“ zurück. Es gibt drei Arten von Tundra: arktische Tundra, alpine Tundra und antarktische Tundra. In der Tundra besteht die Vegetation aus Zwergsträuchern, Seggen und Gräsern, Moosen und Flechten. In einigen Tundragebieten wachsen vereinzelte Bäume. Das Ökoton (ökologischer Grenzbereich) zwischen der Tundra und dem Wald wird als Baumgrenze oder Waldgrenze bezeichnet.
Nutzung
Rangelandgebiete produzieren eine Vielzahl von Gütern und Dienstleistungen, die von der Gesellschaft nachgefragt werden, darunter Viehfutter (Beweidung), Lebensraum für Wildtiere, Wasser, Bodenschätze, Holzprodukte, Erholung in der Natur, Freiflächen und natürliche Schönheit. Aufgrund ihrer geographischen Ausdehnung und ihrer vielen wichtigen Ressourcen sind Rangelandflächen für die Menschen überall auf der Welt von entscheidender Bedeutung, was ihre richtige Nutzung und Bewirtschaftung angeht.
Rangeland ist ein wichtiges wirtschaftliches Gut, das insbesondere durch die Viehhaltung einen wesentlichen Beitrag zur Volkswirtschaft leistet. In Äthiopien beispielsweise machen Rangeland 19 % des nationalen BIP aus, während es in Brasilien durch die Viehhaltung ein Drittel zum BIP der Agrarwirtschaft beiträgt. Diese riesigen Flächen unterstützen nicht nur die direkte landwirtschaftliche Produktion, sondern stärken auch verwandte Industriezweige, verbessern die Beschäftigungslage und fördern das Wirtschaftswachstum.
Weitere Informationen:
Als Ranker wird ein schwach entwickelter und flachgründiger Boden bezeichnet, der auf kalkarmen bis kalkfreien Festgestein wie Sandstein, Granit oder Quarz entsteht. Der Name leitet sich von Rank (österr. = Berghalde, Steilhang) ab. Der Bodentyp weist zwei Horizonte auf und wird in die Klasse R (Ah/C-Böden) eingeteilt.
Wenn sich auf Festgestein eine dünne Schicht Boden gebildet hat, ist ein frühes Stadium der Bodenentwicklung erreicht (Syrosem). Der Boden wird durch fortschreitende Humusbildung, Ablagerung von Staub und Verwitterung des Gesteins zunehmend mächtiger. Sobald die Bodenschicht mehr als 2 cm misst, gehen aus dem Syrosem höher entwickelte Bodentypen hervor – die Böden der Klasse R (Ah/C-Böden). Auf kalkarmen bis kalkfreien Gesteinen (Quarzit, Tonstein, Sandstein oder Schluffstein) sind das die Ranker. Damit ist die Bodenentwicklung aber nicht abgeschlossen. Im weiteren Verlauf kommt es zur Verbraunung und Verlehmung, so dass sich ohne weitere Störungen ein B-Horizont bildet und das Folgestadium erreicht wird (Braunerde). Am Ende der Bodenentwicklung steht meist der Podsol; in seltenen Fällen (Tonstein) die Terra fusca.
Ranker sind in Mitteleuropa typisch für die Hanglagen der Mittelgebirge, wenn entsprechende Ausgangsgesteine anstehen. Für Mitteldeutschland sind dies beispielsweise im Harz der Granit oder im Wiehengebirge der Sandstein. Der Bodentyp kommt, wie bereits die Namensherkunft schließen lässt, nur an Hangpositionen dauerhaft vor, da nur dort die Erosion der (schnellen) Weiterentwicklung des Bodens entgegenwirkt. Darüber hinaus sind Ranker heutzutage aufgrund menschlicher Tätigkeit weitaus häufiger als früher. So kam es auf vielen Ackerflächen an Hanglagen zu einer Bodenerosion. Dadurch wurden höhere Entwicklungsstadien abgetragen und erneut Ranker erreicht. Ranker finden sich auch in den Hochlagen der Mittelgebirge und in Hochgebirgen wie den Alpen, wo steile Hanglagen, Erosion und schwer verwitterbare Quarzite oder kieselsäurehaltige Gesteine nur die Entwicklung von sauren, nährstoffarmen Rankern zuließen.
Der Ranker besitzt laut Deutscher Bodensystematik die Horizontierung Ah/imC. Ah: Der Oberbodenhorizont (A) ist humos (h). Er besitzt eine Mächtigkeit von mindestens 2 cm und maximal 30 cm (andere Ah/C-Böden 40 cm). Unter landwirtschaftlicher Nutzung kann auch die Bezeichnung Ap (p = gepflügt) vorkommen.
Ranker in der Wimbachklamm in den Berchtesgadener Alpen
mit Ah/ixC-Profil
Unter dem etwa zehn Zentimeter mächtigen, steinreichen Oberboden mit Krümelgefüge (Ah-Horizont) folgt im ixC-Horizont (i = kieselig oder silikatisch, x = steinig) das oberflächlich verwitterte, reine Kieselgestein des Juras (Radiolarit).
Quelle: Alexander Stahr
Ranker sind schwach entwickelte, sehr flachgründige Böden, die vom darunter befindlichen Festgestein geprägt sind (zum Beispiel Granit, Schiefer, Radiolarit oder Quarzit). Der Kalkgehalt liegt per Definition unter zwei Prozent und der humose Oberboden (Ah-Horizont) ist nicht mächtiger als 30 Zentimeter.
Da zahlreiche Gesteine in Frage kommen, können die Eigenschaften variieren. Durch das kalkarme Ausgangsmaterial sind die pH-Werte des Bodens aber in aller Regel sauer. Auf quarzreichen Gesteinen wie Sandstein, Quarzit oder Granit sind Ranker überwiegend nährstoffarm (dystroph). Liegt dagegen kalkarmes aber nährstoffreicheres Gestein vor wie Glimmerschiefer, Schluffstein oder Tonstein, können sie auch nährstoffreich sein (eutrophe Ranker bzw. Eu-Ranker). Während Eu-Ranker hochwertige Humusformen (Mull) und Mineralisierungsraten aufweisen, sind die Verhältnisse für den Abbau organischer Stoffe auf dystrophen Rankern schlecht. So bilden sich die ungünstigen Humusformen Moder und Rohhumus sowie nicht umgesetzte Laubauflagen, die wiederum die Podsolierung fördern. Eine wesentliche Eigenschaft aller Ranker ist die Flachgründigkeit durch das nah anstehende Festgestein.
Ein relativ geringer Ton- und Humusgehalt im Ah-Horizont lässt kaum die Bildung von Ton-Humus-Komplexen zu. Daher ist die Austauschkapazität von Nährstoffen und der Nährstoffnachschub aus dem basenarmen Ausgangsgestein sehr gering. Verhindert die mangelnde Verlehmung eine ausreichende Speicherung von Wasser, so ist die Durchlüftung des Bodens hingegen recht gut.
Ranker haben ein geringes landwirtschaftliches Ertragspotential. Wegen der häufigen Hanglage, Flachgründigkeit und Nährstoffarmut werden sie in Mitteleuropa nur noch selten als Acker genutzt. Auf landwirtschaftlichen Flächen überwiegt eine Nutzung als extensives Grünland. In südexponierten Lagen, z. B. des Kaiserstuhls, dienen sie auch dem Weinbau.
Bedeutend ist vor allem die forstwirtschaftliche Nutzung. Durch den steinigen, geringmächtigen Untergrund bieten Ranker jedoch nicht allen Bäumen einen hinreichenden Standort. Es dominieren Nadelbäume wie Tannen und Fichten. Die forstliche Nutzung ist zwar nicht besonders wirtschaftlich, jedoch zum Erhalt und Schutz der Bodendecke zweckmäßig.
Raps (Brassica napus) ist eine relativ junge Kulturpflanze, jedoch eine wirtschaftlich sehr bedeutende Nutzpflanze. Wahrscheinlich ist er aus einer Kreuzung zwischen dem Wilden Gemüsekohl (Brassica oleracea) und Rübsen (Brassica rapa) im Mittelmeerraum, dem Kontaktgebiet beider Ausgangssippen, hervorgegangen.
Während die frühesten Hinweise des Rapsanbaus in Indien auf 2.000 v. Chr. datieren, begann die europäische Karriere der Rapspflanze in der Römerzeit. Wegen des hohen Ölgehalts der Pflanzen begannen die Römer mit dem Anlegen erster Rapskulturen. Ursprünglich stammt der Raps aus dem östlichen Mittelmeerraum. Dort wurde es zur Gewinnung von Speise- und vor allem Lampenöl verwendet.
Den ersten planmäßigen Anbau der Rapspflanze in der Neueren Geschichte starteten die Niederlande. Hier konzentrierte man sich vor allem auf das sogenannte Rüböl als Brennstoff für Öllampen. Ausgehend von den Niederlanden hat sich der Raps in der norddeutschen Tiefebene ausgebreitet. Die Industrialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts und dem steigenden Bedarf an technischen Ölen waren die vornehmlichen Gründe, weshalb sich der Anbau in anderen Teilen Deutschlands und Europa ausweitete. Nach und nach setze sich Rapsöl auch als Nahrungsmittel durch. Aufgrund dessen mussten die Anbauflächen stark vergrößert werden. Bereits zu dieser Zeit dachte man auch beim Rapsanbau ökonomisch und verwendete die Pressrückstände bereits als energiereiche Tiernahrung.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden günstig importiertes Petroleum und importierte Pflanzenöle eine starke Konkurrenz zum Rüböl. Demzufolge sank die Nachfrage.
In der Folge diente Rapsöl vornehmlich als Lampenöl, Schmiermittel in Dampfmaschinen und als Grundstoff für die Seifenherstellung. Die Einführung von Sorten mit nur noch geringen Erucasäure- und Glucosinolatgehalten in den 1970er Jahren und weiterer Züchtungsfortschritt ermöglichten eine Nutzung von Raps als hochwertiges Speiseöl und als Futtermittel. Inzwischen wird ein nicht unerheblicher Anteil für die Biokraftstoffproduktion weiterverarbeitet.
Raps ist eine einjährige Krautpflanze mit aufrechter, verzweigter Sprossachse. Sie gehört zur Familie der Kreuzblütengewächse, wie Rübe und Kohl. Die Kohlrübe ist eine Kulturform des Rapses. Die Rapspflanze erreicht eine Wuchshöhe von 30-150 cm. Die Pflanzen sind von grau-blauer Farbe und bilden eine Pfahlwurzel aus.
Raps gedeiht unter den Klimabedingungen in Deutschland und enthält in den Früchten etwa 40 % Öl. Das bei der Verarbeitung in den Ölmühlen anfallende Rapsschrot ist ein gutes Eiweißfutter (Schrot). Raps verbessert die Bodenstruktur und ist deshalb für die Fruchtfolge besonders wertvoll. In Deutschland wird überwiegend nur Winterraps angebaut. Die leuchtend gelb blühende Pflanze prägt im Frühjahr das Landschaftsbild vieler Regionen.
Milde Lehmböden eignen sich besonders gut für den Anbau. Als Grundregel gilt: Ein guter Weizenboden ist auch ein guter Rapsboden. Die günstigste Saatzeit für den Winterraps liegt um den 15. August. Geerntet wird er im Juli des nächsten Jahres. Raps wurzelt tief und lockert dabei den Boden auf. Nachfolgende Kulturpflanzen können dann leichter wachsen. Mit seinen tiefen Wurzeln erschließt der Raps auch Nährstoffe und hinterlässt sie den nachfolgenden Früchten. Nach Raps werden deshalb häufig Weizen, Gerste, oder Roggen angebaut, denn Raps als Vorfrucht bewirkt einen höheren Kornertrag bei Getreide. Heute ist Raps die mit Abstand bedeutendste Ölpflanze in Deutschland. Er wird auf einer Fläche von ca. 954.200 ha Hektar (2020) angebaut. Für die Ölgewinnung wird in Deutschland hauptsächlich Winterraps angebaut da er höhere Erträge - bis 45 dt pro ha - als Sommerraps bringt.
In erster Linie wird Rapsöl aus der Rapssaat gewonnen. Dieses Rapsöl wird als Speiseöl, Futtermittel und als Biokraftstoff genutzt. Weiter wird Rapsöl in der chemischen Industrie verwendet und dient als Grundstoff für Materialien wie Farben, Kunststoffe und Kaltschaum.
Je nach Verarbeitungsmethode fallen ca. 66 % der Rapssaatmasse als Koppelprodukte (Rapskuchen, Rapsexpeller, Rapsextraktionsschrot) an. Diese Produkte bleiben nicht ungenutzt, sie werden als Tierfutter verwendet. Ein weiteres Nebenprodukt bei der Rapsölverarbeitung zu Biodiesel ist Glycerin. Auch dieses findet Verwendung in der Futtermittel- oder in der chemischen Industrie.
Seit etwa dem Jahrtausendwechsel hat sich Rapssaat zu einem wichtigen Bioenergieträger entwickelt. Rapsöl wird dabei vor allem für die Biokraftstoffe und Biodiesel genutzt. Ebenfalls fungiert das Öl als Treibstoff in Pflanzenöl-Blockheizkraftwerken (BHKW) und als Brennstoff für spezielle Ölheizungen.
Rapsöl wird nicht nur für die Ernährung verwendet, sondern auch als Treibstoff für Motoren (Biodiesel) oder technisches Öl, z.B. für Kettensägen.
Raps ist in Deutschland die bei weitem die wichtigste Ölsaat. Auch in der EU spielt Raps, gefolgt von Sonnenblumen und Soja, wenn auch nicht so dominant wie in Deutschland, die entscheidende Rolle. Deutschland und Frankreich sind sowohl Haupterzeugerländer von Raps, als auch führend bei der Herstellung von Rapsöl.
Raps-Importe nach Deutschland, 2021v in %
(Werte in Klammern stellen die Anteile des Vorjahres dar)
Die wichtigsten Handelspartner bezüglich der Rapsimporte nach Deutschland waren 2021 Australien mit 18 %, die Niederlande mit 16 %, Frankreich mit 15 % und die Ukraine mit 13 %. Am meisten zugelegt im Vergleich zu 2020 haben Australien (+260 %), Tschechien (+50 %) und Frankreich (+15,4 %)
Quelle: BLE
Weitere Informationen:
Untergruppe einer Art mit bestimmten Eigenschaften, die weitervererbt werden. In der Landwirtschaft spielen Zuchtrassen bei allen Nutztieren eine Rolle. Daneben gibt es Hybriden d.h. durch Kreuzung gezüchtete Tiere, die ihre Eigenschaften nicht weiter vererben.
Weitere Informationen:
Alle getrockneten Futterarten im Gegensatz zum Saftfutter. Zum Raufutter zählen Grasheu, Feldfutterheu und Stroh (Angaben variieren). Raufutterfresser sind Pferde, Rindvieh, Schafe und Ziegen.
Akronym für Regionalisiertes Agrar- und Umweltinformationssystem; es ist ein an der Universität Bonn im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten entwickeltes Politikinformationssystem, das den gesamten Agrarsektor der Bundesrepublik inhaltlich, methodisch und technisch einheitlich erfasst und abbildet. Mit RAUMIS steht ein Informationssystem zur differenzierten Analyse und Prognose der agrarischen Entwicklung und der landwirtschaftlich bedingten Umweltwirkungen unter alternativen Agrar- und Umweltpolitiken zur Verfügung.
RAUMIS ist ein positiv mathematischer Programmierungsansatz mit nicht-linearer Zielfunktion. Das Modell bildet regionale Anpassungen der Landwirtschaft in Deutschland auf agrar- und agrarumweltpolitischen Maßnahmen im Rahmen einer komparativ-statischen Betrachtung ab.
Entwicklungen auf den Weltagrarmärkten, vor allem der Preise, bilden die exogenen Rahmendaten für RAUMIS, welches das Anpassungsverhalten der Landwirtschaft Deutschlands auf regionaler Ebene simuliert. Das Modell bildet die gesamte landwirtschaftliche Erzeugung des deutschen Agrarsektors mit seinen intrasektoralen Verknüpfungen konsistent zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR) ab. Das heißt, dass die Produktion von über 50 landwirtschaftlichen Produkten abgebildet wird, wie sie in einer Positivliste der LGR formuliert sind.
Das Modell erfasst den gesamten Input, der zur Erzeugung dieser landwirtschaftlichen Produktion notwendig ist. Die Einkommensbegriffe entsprechen ebenfalls den Definitionen der LGR. Als räumliche Abbildungsebene dienen 326 Regionshöfe, die weitgehend den Landkreisen in Deutschland entsprechen. Über diese starke regionale Differenzierung finden die sehr heterogenen natürlichen Standortbedingungen in Deutschland sowie die unterschiedlichen Betriebsstrukturen Berücksichtigung. Gleichzeitig wird hier durch eine kleinräumliche Ebene zur Untersuchung der Agrarumweltbeziehungen erreicht. Für jeden dieser Modellkreise wird eine aktivitätsanalytisch differenzierte Matrize aufgestellt.
Die Raumordnung entwickelt übergeordnete und umfassende Leitvorstellungen für eine ausgewogene, dem Wesen des Menschen gemäße Raumstruktur des gesamten Staatsgebietes und schafft zugleich Instrumente für deren Verwirklichung; konkret und schwerpunktmäßig bemüht sie sich um eine Beseitigung bzw. Reduzierung räumlicher Disparitäten und strebt so eine gleichwertige Entwicklung der Teilräume an. Raumordnung beschränkt sich somit nicht auf eine Zustandsbeschreibung, sie ist auf Veränderungen und zielorientiertes Handeln ausgerichtet.
Als raumprägender und mit anderen Nutzern um Flächen konkurrierender Wirtschaftssektor hat die Landwirtschaft vielfältige Beziehungen zur Raumordnung. Die Landes- und Regionalplanung entscheidet in dem Maße, in dem sie zur Lösung von Flächennutzungskonflikten beiträgt, auch über den Einfluss der Landwirtschaft auf die räumliche Entwicklung.
Weitere Informationen:
Oberbegriff für raum- bzw. flächenbezogene Planungen auf Bundes-, Landes-, Regions- und Gemeindeebene. Sie erfolgt durch Aufstellung von Plänen und Programmen, die darauf ausgerichtet sind, zweckmäßigste Maßnahmen zur Erreichung eines bestimmten Zieles innerhalb einer gegebenen Zeit einzusetzen.
Eine extensive, ungepflegte Gebirgsweide oberhalb der Kultivierungsgrenze.
Auch Freiteilbarkeit; Vererbung des landwirtschaftlichen Betriebes an alle Erbberechtigten. Es muß daraus jedoch keine tatsächliche Aufsplitterung eines Betriebes erfolgen. In der Regel dient der Grund und Boden als Teilungsmasse, während das eigentliche Gehöft von der Teilung ausgespart bleibt. Dennoch gibt es z.B. im südwestdeutschen Raum auch Hofgebäudeteilungen bis hin zum Stockwerkseigentum. Im Extrem kam es bei der Aufteilung von Stuben innerhalb von Häusern unter jeweils mehreren Eigentümern im Oberinntal und im Trentino zur Markierung der Zimmeranteile mit Kohlestrichen auf dem Boden.
Trotz notariell vollzogener Aufteilung des Erbgutes kann der Fortbestand des Betriebes gewahrt werden, wenn einer der Erben oder ein Pächter den Hof übernimmt, die anderen Erben in nichtlandwirtschaftlichen Berufen tätig sind und Pachtgeld beziehen. Die freie Teilbarkeit des Bodeneigentums ist den politisch-gesellschaftlichen Ideen des Liberalismus, der Gleichheit und Gerechtigkeit verpflichtet. Das Prinzip, allen Erbberechtigten die gleichen Startchancen zu bieten, hat Vorrang vor der Sicherung des Hofes, der sogenannten Hofidee, die das Anerbenrecht prägt. Die Folge ist ein ständiger Auf- und Abbau der landwirtschaftlichen Betriebe.
Für die landwirtschaftliche Betriebsplanung auf lange Sicht bedeutet die Erbsitte der Freiteilbarkeit ohne Zweifel eine Erschwernis. Jede Generation muß neu disponieren und auch die Mühen des Betriebsaufbaus erneut auf sich nehmen. Nicht zuletzt führt die Mobilisierung des Bodens häufig zu überhöhten Bodenpreisen, die in keinem Verhältnis mehr zur Ertragsfähigkeit stehen und somit Überschuldungen zur Folge haben.
Auch wo jeder Erbe sein Erbteil für sich in Anspruch nimmt, bedeutet die Realteilung als vorherrschende Erbsitte nicht zwingend eine fortgesetzte Verkleinerung der landwirtschaftlichen Betriebe, weil durch Heirat und Zukauf sich die Betriebe auch wieder vergrößern lassen. Die Mobilität des Bodens ist in Realteilungsgebieten meist größer als in Gegenden mit vorherrschendem Anerbenrecht. Vor allem sind Stückelung und Gemengelage des Grundbesitzes in den Realteilungsgebieten meist sehr beträchtlich (Flurform). Das bedeutet überdurchschnittlich lange Fahrtzeiten, Erschwerung des Maschineneinsatzes etc.
Durch das Bestreben der Landwirte große Schläge zu bewirtschaften, werden vielfach Flächen getauscht bzw. zusammengelegt. Für den Betrachter sind dann auch in einem typischen Realteilungsgebiet die zugrundeliegenden kleinen Flurstücke nicht mehr erkennbar und vermitteln eine scheinbar normale Flächenstruktur.
Zu den besonderen Vorzügen der Realteilung gehört neben der größeren Erbgerechtigkeit, dass für jeden Erben Anreize zu wirtschaftlichem, und sozialem Aufstieg geschaffen sind, Tüchtigkeit und innovatives Handeln werden damit gefördert. Der Zwang zur Abwanderung großer Teile der jungen Generation ist daher in Realteilungsgebieten, die meist eine wachsende Bevölkerung aufweisen können, nicht so stark. Charakteristisch ist die berufliche Mischung von Landwirten und Nichtlandwirten. Viele Kleinbauern suchen eine Neben- oder Zuerwerbstätigkeit, so dass in den Realteilungsdörfern (z.B. in Süddeutschland) häufig ein reichhaltiges Handwerk und Gewerbe ausgebildet ist. Es erscheint fast konsequent, dass in diesem innovations- und gewerbefreundlichen Umfeld auch die Industrialisierung einen günstigen Ansatz fand.
Realteilung galt im mittleren Neckarraum von Heilbronn im N bis nach Tuttlingen im S und vom Ostrand des Schwarzwaldes bis zu einer östlichen Linie, die etwa von Mergentheim über Backnang, Göppingen, Münsingen, Sigmaringen bis Überlingen reicht. Sie galt außerdem im Oberrheintal und im Kraichgau.
Im größeren Teil des Schwarzwalds und im östlichen wie südlichen Teil des Landes wurden die landwirtschaftlichen Betriebe geschlossen vererbt. In den Randgebieten und in den früheren Kreisen Lörrach und Heidenheim waren Mischformen des Erbrechts maßgebend, die heute in weiten Teilen des früheren Realteilungsgebiets übernommen werden. Die weite Verbreitung der Freiteilbarkeit bewirkte eine starke Zersplitterung der LN in Baden-Württemberg.
Da die Aufteilung bei jedem Erbgang stattfindet, nimmt von Generation zu Generation die Kleinparzellierung der Flurstück zu. Das Ergebnis dieser Zersplitterung ist eine Vielzahl kleiner Parzellen, die zunehmend ineffizient zu bewirtschaften sind. Die Folge ist oft eine Neuordnung der Feldflur in Form von Flurbereinigungen und freiwilligen Zusammenschlüssen. Durch das Bestreben der Landwirte große Schläge zu bewirtschaften, werden vielfach Flächen getauscht bzw. zusammengelegt. Für den Betrachter sind dann auch in einem typischen Realteilungsgebiet die zugrundeliegenden kleinen Flurstücke nicht mehr erkennbar und vermitteln eine scheinbar normale Flächenstruktur.
Eine weitere Folge dieser Struktur ist ein hoher Anteil an Nebenerwerbslandwirten, die nebenbei ein Handwerk betreiben oder in der Industrie tätig sind.
Die Industrialisierung des Landes im 19. Jahrhundert hatte ihre Schwerpunkte in den Realteilungsgebieten: kleine Betriebsgrößen erzwangen den Zuerwerb. Die weite Streuung der Industrie ermöglichte die enge, für Baden-Württemberg charakteristische Symbiose von Landwirtschaft und Industrie. Diese Verbindung gewährte einen wichtigen Rückhalt in Krisenzeiten. Im Hegau und dem Bodenseeraum beispielsweise liegt Realteilung insbesondere in Altsiedelgebieten wie dem Bodenseeuferstreifen vor (kleinparzellierte, schmalstreifige Fluren, fortgeschrittene Angleichung der Betriebsgrößen, dichtbebaute, z.T. ummauerte Dörfer). Bei Intensivkulturen warfen die immer kleiner werdenden Betriebseinheiten noch ausreichenden Lebensunterhalt ab (z.B. Hagnau, Sipplingen).
Vergleicht man die Verdichtungszonen nach dem Landesentwicklungsplan mit der Verteilung nach dem Vererbungsrecht, fällt auf, dass die Anerbengebiete weitgehend ländlich geprägt sind, während die Verdichtungszonen Baden-Württembergs sich hauptsächlich mit dem Realteilungsgebiet in Deckung bringen lassen.
(s. a. Erbrecht)
Auch Weinberg, Weingarten, Wingert oder Wengert, eine für den Weinbau landwirtschaftlich genutzte Fläche in Steil-, Hang- oder Flachlage (trotz des Namensteils 'berg'). Dies kann ein relativ kleiner Bereich (in Besitz eines einzigen Eigentümers), aber genauso gut ein sehr großer Bereich sein, den sich viele Besitzer teilen. Es muss sich auch nicht in jedem Fall um eine zusammenhängend mit Rebstöcken bepflanzte Fläche handeln. Bei einer Zersplitterung spricht man von Streuweinberg.
Mehrere nebeneinanderliegende Einzelgrundstücke ergeben eine gemeinsame Einzel- oder Großlage mit vergleichbaren Standortbedingungen hinsichtlich Geologie und Klima, diese Lagen sind wiederum einem Weinbaugebiet zugeordnet.
Lagen und Weinbaugebiete stellen geographische Herkünfte dar und haben nur bedingt Aussagekraft auf die Weinqualität. In der Regel bilden Weinberge mehr oder weniger geschlossene Flächenareale, die besonders in den nördlichen Anbaugebieten klimatische Vorzüge besitzen und schon lange weinbaulich genutzt werden. Einzelne Rebanlagen im Gelände werden als Streuweinberge bezeichnet. Sie liegen oft im klimatischen Grenzbereich oder sind letzte Zeugen eines früher sehr umfangreichen Weinbaus. Besonders steile und schwer zu bewirtschaftende Weinberge fallen vielerorts der Sozialbrache anheim und verbuschen. Weinberge sind auf der Nordhalbkugel meist nach Süden oder Westen exponiert, um die Sonneneinstrahlung optimal zu nutzen.
Je nach Steilheit der Lage sind traditionelle Weinberge zur Verringerung der Hangneigung mit Trockenmauern terrassiert. Durch die Rebflurbereinigung wurden viele historische Trockenmauern entfernt, um die maschinelle Bewirtschaftung zu erleichtern und die Zufahrt zu ermöglichen.
Eine moderne, wirtschaftlich genutzte Weinbergsanlage dient heute in aller Regel nur zur Produktion von Weintrauben, Tafeltrauben oder Rosinen. Gärtnerisch genutzte Rebenmischkulturen sind mit der Mechanisierung und Spezialisierung der Weinbaubetriebe zunehmend verschwunden. Vom Mittelalter bis etwa 1900 war es üblich, auch Obst, Gemüse und Kräuter auf derselben Fläche zur Eigenversorgung oder zur Vermarktung anzubauen, wobei die Rebe immer die Hauptfrucht darstellte. Zur weiteren Nebennutzung wurde das abgeschnittene Rebholz zum Heizen und entfernte Triebspitzen als Grünfutter für Tiere verwendet, heute dienen diese organischen „Abfälle“ als wertvolle Humuslieferanten. Auch herrscht heute der sortenreine Anbau vor, früher war es gebräuchlich, mehrere Sorten gemischt zu pflanzen. Traditionelle Einzelpfahlsysteme, wie sie heute noch teilweise an der Mosel und anderen Steillagengebieten vorzufinden sind, wichen der modernen Spaliererziehung am Drahtrahmen. Die Rebstöcke sind maschinengerecht angelegt, der Abstand der Rebzeilen ist gleichmäßig und beträgt in Direktzuglagen etwa 2 m, um Schmalspurtraktoren und Traubenvollernter optimal einsetzen zu können. Die Stockabstände liegen bei 1 bis 1,20 Metern. Die Rebzeilen selbst verlaufen meist in senkrechter Linie zum Hang. Bei quer ziehenden Zeilen, die jeweils abgeböscht sind, spricht man von Querterrassierung, was besonders in sehr steilen Flächen eine Bewirtschaftung ermöglicht.
Die Neuanlage von Weinbergen ist in allen EU-Ländern genehmigungspflichtig. In der Regel wird dies in Deutschland durch Landesverordnungen geregelt. Sofern der angebaute Wein nur dem Eigenverbrauch dient, ist eine Fläche bis zu einem Ar genehmigungsfrei.
Weinberge sind vom Menschen geschaffene Kulturlandschaften und die mit am stärksten beeinflussten Agrarökosysteme. Meist werden sie sehr intensiv bewirtschaftet und als Monokulturen gesehen, andererseits sind sie aber auch bedeutende Rückzugsgebiete von Pflanzen und Tieren. Sie bilden ein eigenes Ökosystem, denn zum Weinberg gehören nicht nur die Rebzeilen, sondern auch weitere Kulturlandschaftselemente wie Trockenmauern, Stützmauern, Steinriegel, Hohlwege, Raine und Hecken, welche auch das typische Landschaftsbild von durch Weinbau dominierten Landschaften entscheidend mitprägen.
Durch die Flurbereinigung in den 1960er und 1970er Jahren, der damit verbundenen Schaffung von größere Parzellen und durch den in den letzten Jahrzehnten vermehrten Einsatz von Maschinen zur Bewirtschaftung der Weinberge änderten sich die Bedingungen. Trotzdem ist auch hier noch die Schaffung von ökologischen Nischen möglich.
Weitere Informationen:
Siehe Weinrebe
In der EU-Statistik sind Rebflächen die mit Reben (Keltertrauben, Tafeltrauben) bestockten Flächen und Jungfelder, unabhängig davon, ob sie im Ertrag stehen oder nicht, sowie die Rebbrache als gegenwärtig nicht mit Reben bestockten Flächen, die für eine Bepflanzung mit Reben vorbereitet werden. Rebschulen und Rebschnittgärten einschließlich der Unterlagenschnittgärten zählen ab 2010 zu den Baumschulen.
Weitere Informationen:
Der Rebstock oder Weinstock ist die kultivierte Wuchsform der Weinrebe. In der Regel sind die Rebsetzlinge (Setzhölzer) heute Pfropfreben, bei denen auf eine Unterlage aus einer reblaustoleranten Unterlagensorte ein Reis (kleiner Zweig) einer edlen Rebsorte aufgepfropft wird. Damit werden die Eigenschaften beider Rebsorten kombiniert, insbesondere die Reblausresistenz des (amerikanischen) Wurzelstocks mit den die Weinqualität bestimmenden Eigenschaften der aufgepfropften (europäischen) Edelreiser. Je nach Erziehungssystem erhält das alte Holz eine charakteristische Form. In der Vegetationsruhe (Winter bis Frühjahr) wird der Rebstock geschnitten. Der dann im Frühjahr austretende, reichhaltige Wundsaft wird Rebtränen, Rebwasser oder Rebenblut genannt.
Die biologische Uhr bestimmt die Leistungsfähigkeit des Rebstocks. Der erste Ertrag stellt sich oft erst im dritten Jahr ein, bis zum 20. Jahr trägt er reichlich. Mit zunehmendem Alter verliert der Rebstock jedoch seine Fruchtbarkeit, er beginnt weniger Früchte zu bilden, diese sind aber im Hinblick auf die Konzentration der Inhaltsstoffe denen von jüngeren Reben oft überlegen. Je älter ein Weinstock, desto tiefer reichen seine Wurzeln (abhängig von der Unterlagensorte), mit denen er dann auch in trockenen Sommerperioden immer noch genug Wasser aus den Boden ziehen kann.
Weitere Informationen:
Die Rechtsform ist der allgemein rechtliche Rahmen eines Unternehmens zur Regelung von Personen- und Gruppeninteressen im Innen- und im Außenverhältnis:
Den landwirtschaftlichen Betrieben sind mit Rücksicht auf die Besonderheiten der landwirtschaftlichen Tätigkeit und der Agrar- und Unternehmensstruktur steuerliche Erleichterungen eingeräumt. Diese gelten für gewerbliche Unternehmen im Agrarsektor nicht oder nur eingeschränkt.
Landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland nach Rechtsformen 2020
Nach Rechtsformen betrachtet dominieren die landwirtschaftlichen Einzelunternehmen, die in der Regel als Familienbetriebe geführt werden. Nach Ergebnissen der Landwirtschaftszählung 2020 zählen 87 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe Deutschlands zu den Einzelunternehmen und 11 Prozent zu den Personengesellschaften. 2 Prozent der Betriebe gehören zur Rechtsform der juristischen Personen (GmbH, Genossenschaft, AG). Allerdings bewirtschaften Einzelunternehmen nur 62 Prozent der Fläche. Personengesellschaften und juristische Personen weisen dagegen mit 21 bzw. 17 Prozent relativ hohe Flächenanteile aus. Juristische Personen existieren vor allem in den neuen Bundesländern. Sie bewirtschaften dort 50 Prozent der Fläche.
Quelle: Statistisches Bundesamt nach DBV Situationsbericht 2023
Nach Rechtsformen betrachtet dominieren in Deutschland die landwirtschaftlichen Einzelunternehmen, die in der Regel als Familienbetriebe geführt werden. So zählten 2013 90 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe Deutschlands zu den Einzelunternehmen und 8 Prozent zu den Personengesellschaften.
Als Einzelunternehmen wird die von einer einzelnen natürlichen Person betriebene selbstständige Betätigung bezeichnet. Grundsätzlich ist das Einzelunternehmen dadurch gekennzeichnet, dass der Inhaber sein Unternehmen ohne Gesellschafter führt. Der Einzelunternehmer haftet unbeschränkt und allein für die Verbindlichkeiten seines Unternehmens mit seinem Betriebs- und auch mit seinem Privatvermögen.
Knapp 2 Prozent der Betriebe gehörten zur Rechtsform der juristischen Personen (GmbH, Genossenschaft, AG). Vor allem durch zahlreich neu entstandene GmbHs ist die Zahl der juristischen Personen zwischen 2010 und 2013 von rund 5.100 auf rund 5.300 angestiegen (einschließlich juristische Personen des öffentlichen Rechts). In den neuen Bundesländern ist die vergleichsweise hohe Zahl von 3.800 Kapitalgesellschaften, eingetragenen Genossenschaften und Aktiengesellschaften tätig. Im früheren Bundesgebiet haben 1.400 Unternehmen die Rechtsform einer juristischen Person gewählt.
Die Zahl der Personengesellschaften und GmbHs hat seit 1999 deutlich zugelegt, während Einzelunternehmen aber auch Genossenschaften deutlich weniger geworden sind. Die starke Zunahme der Personengesellschaften, vor allem in Form von Gesellschaften bürgerliches Rechts (GbR), hat besonders im früheren Bundesgebiet stattgefunden.
Personengesellschaften sind regelmäßig gekennzeichnet durch ein persönliches Verhältnis unter den Gesellschaftern. Diese verfolgen mit der Gründung der Gesellschaft einen gemeinsamen Zweck. Ein Wechsel eines Gesellschafters ist grundsätzlich nur mit dem Einverständnis der anderen Gesellschafter möglich; der Austritt aller Gesellschafter führt zum Erlöschen der Gesellschaft. Die Gesellschafter haben die
Verpflichtung, die vertraglich vereinbarten Beiträge zu leisten.
GmbHs sind eine in der LuF, vor allem in den östlichen Bundesländern, verbreitete Gesellschaftsform. Die Organisation der GmbH ist einfach, sie hat im Regelfall nur zwei Organe: den Geschäftsführer, der nicht aus dem Kreis der Gesellschafter bestellt werden muss, und die Gesellschafterversammlung. Der Geschäftsführer ist im Innenverhältnis der Gesellschafterversammlung gegenüber grundsätzlich weisungsgebunden. Bei der GmbH ist die Haftung der Gesellschafter auf die Stammeinlage beschränkt. ....
Vor allem durch zahlreiche neu entstandene GmbHs ist die Zahl der juristischen Personen zwischen 2010 und 2020 von rund 5.100 auf rund 5.900 angestiegen (einschließlich juristische Personen des öffentlichen Rechts). In den neuen Bundesländern ist eine vergleichsweise hohe Zahl von 3.900 Kapitalgesellschaften, eingetragenen Genossenschaften und Aktiengesellschaften tätig. Im früheren Bundesgebiet haben 2.100 Unternehmen die Rechtsform einer juristischen Person gewählt. Von den juristischen Personen werden in Deutschland rund 17 Prozent der Landwirtschaftsfläche bewirtschaftet, Tendenz insgesamt leicht abnehmend. Während der Flächenanteil der Agrargenossenschaften deutlich rückläufig ist, nimmt der Bewirtschaftungsanteil der GmbHs kräftig zu.
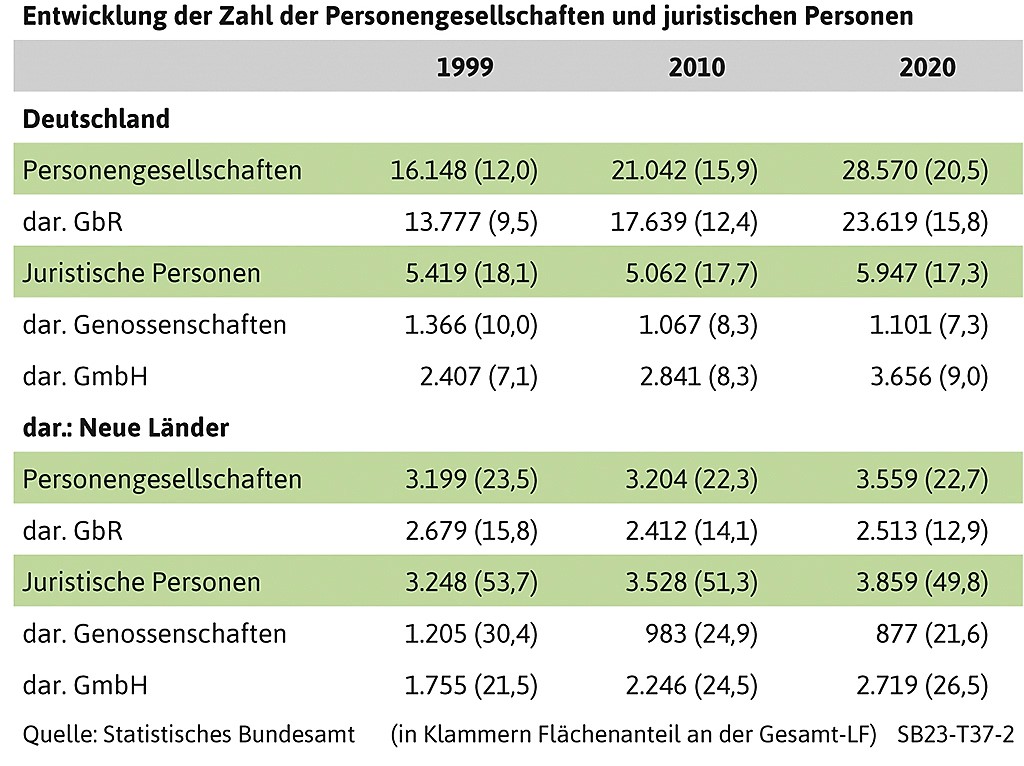
Quelle: Statistisches Bundesamt nach DBV Situationsbericht 2023
Im Osten Deutschlands haben die landwirtschaftlichen Personengesellschaften in der Rechtsform der GmbH & Co. KG zugenommen. Von GmbHs werden mittlerweile 9 Prozent der Agrarfläche Deutschlands bewirtschaftet. Im Osten Deutschlands sind es sogar entsprechend 27 Prozent.
Weitere 22 Prozent der Fläche werden dort von Agrargenossenschaften bewirtschaftet. Genossenschaften verfolgen als Wertegemeinschaften in der Regel wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ziele ihrer Mitglieder, die über jene reiner Wirtschaftsbetriebe hinausgehen. Grundlegende genossenschaftliche Werte sind etwa Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Demokratie, Gleichheit, Billigkeit und Solidarität. Grundsätzlich ist eine Gleichberechtigung der Mitglieder gegeben.
Besonders stark ging die Zahl der Einzelunternehmen zurück. Die Einzelunternehmen stellen nach Ergebnissen der Landwirtschaftszählung 2020 zwar 87 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe, bewirtschaften aber nur 62 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche. Zehn Jahre zuvor betrug ihr Bewirtschaftungsanteil noch 66 Prozent, zwei Jahrzehnte zuvor lag ihr Anteil sogar noch bei 70 Prozent..
Weitere Informationen:
Zweite Art von Zersetzern (s.a. Destruenten), die die zerkleinerten organischen Überreste schließlich ganz in ihre anorganischen Ausgangsbestandteile zerlegt, d.h. zu pflanzenverfügbaren Nährstoffen mineralisiert. Man bezeichnet die Reduzenten deshalb auch als Mineralisierer.
Es sind heterotrophe Euglenen (Algen), Bakterien und Pilze, die dafür sorgen, dass sich nicht beliebig viel totes organisches Material ansammelt. Sie leben von diesem Material, bauen es um und ab. Auf diese Weise sorgen Zersetzer dafür, dass sich der Kreislauf der Nährstoffe schließt.
Die Ziele der 1962 eingeführten Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt. Vor dem Hintergrund von Unterversorgung und Hunger in den Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren, dem hohen Anteil der Ausgaben für Lebensmittel an den Haushalten und den ausgeprägten strukturellen Einkommensproblemen in der Landwirtschaft kam der Ernährungssicherung und der Produktivitätssteigerung in den 1960er Jahren große Bedeutung zu. Zur Regelung der Agrarmärkte wurden Marktordnungen geschaffen, was ein "grundlegender Konstruktionsfehler" war: Durch Marktordnungen für landwirtschaftliche Produkte sollten die Preise angehoben, die Landwirte geschützt und deren Einkommen verbessert werden. Kennzeichnend für die meisten Marktordnungen waren ein hoher Außenschutz, Mindesterzeugerpreise (die über dem Weltmarktpreis lagen) und staatliche Aufkäufe zur Preisstützung (Interventionssystem) sowie Exportsubventionen, um Überschüsse auf dem Weltmarkt absetzen zu können.
"Milchseen", "Butter-" und "Getreideberge" sind Metaphern, welche die Öffentlichkeit in den späten 1970er und den 1980er Jahren mit der Agrarpolitik verband, ebenso wie ausufernde Agrarausgaben und subventionierte Agrarexporte mit negativen Auswirkungen auf die Erzeuger in Entwicklungsländern. In den 1980er Jahren wurden von der Gesellschaft zunehmend negative ökologische Auswirkungen der Intensivierung und regionalen Spezialisierung der Landwirtschaft wahrgenommen.
Mehrere Reformen bereiteten den Weg zur Reform der GAP in en zwanziger Jahren. Heute sieht man in der GAP eine Partnerschaft zwischen der Landwirtschaft und der Gesellschaft, zwischen Europa und seinen Landwirten.
Die GAP ist eine gemeinsame Politik für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sie wird aus den Mitteln des EU-Haushalts auf europäischer Ebene finanziert und verwaltet.
Um die europäische Landwirtschaft auf die Zukunft auszurichten, hat sich die GAP im Laufe der Jahre an den Wandel der wirtschaftlichen Gegebenheiten und der Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger angepasst.
Die CAP 2023–2027 trat am 1. Januar 2023 in Kraft. Die Unterstützung für Landwirte und Interessenträger im ländlichen Raum in den 27 EU-Ländern beruht auf dem Rechtsrahmen für die GAP 2023–2027 und den in den von der Kommission genehmigten GAP-Strategieplänen aufgeführten Optionen. Die genehmigten Pläne sollen einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen des europäischen Grünen Deals, der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und der Biodiversitätsstrategie leisten.
Die Landwirtschaft kann man nicht mit anderen Wirtschaftszweigen vergleichen, da sie besonderen Bedingungen unterliegt:
Landwirte sollen nicht nur kosteneffizient arbeiten, sondern auch nachhaltig. Gleichzeitig sollen sie unsere Böden und unsere Artenvielfalt erhalten.
Unternehmerische Unsicherheiten und die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt rechtfertigen die wichtige Rolle, die der öffentliche Sektor für die Landwirte spielt. Die GAP setzt folgende Maßnahmen ein:
Mit der reformierten GAP sollen
Die wichtigsten Elemente der Politik sind:
Um Stabilität und Planungssicherheit zu gewährleisten, bleibt die Einkommensstützung ein wesentlicher Bestandteil der GAP. Dabei gibt es unter anderem folgende Änderungen:
Die GAP schafft die Voraussetzungen dafür, dass die Landwirte ihre Aufgaben in der Gesellschaft erfüllen Dazu gehören:
Lebensmittelerzeugung
Entwicklung des ländlichen Raums
Umweltverträgliche Bewirtschaftungsmethoden
Weitere Informationen:
Fähigkeit des Bodens, im Stoffkreislauf zwischen Abbau und Aufbau ein Gleichgewicht herzustellen.
Zusammenfassender Begriff für alle Gehöftformen mit schematischer Anordnung der Einzelbauten.
(s. a. Hofformen, Einheitshof, Gehöft, Regelgehöft)
Grundtyp der Gehöftformen, der durch die unregelmäßige Anordnung der einzelnen Gehöftbauten gekennzeichnet ist. Wichtigster Einzeltyp ist das "Haufengehöft" mit seinem Schwerpunkt im mittleren Bayern.
(s. a. Hofformen, Einheitshof, Gehöft, Regelgehöft)
Erreichen eines naturnäheren Zustandes im Sinne eines historisch begründeten Zustandes. Der Begriff umfasst den weitestgehenden Ansatz bezüglich des Zeithorizonts und des Zielerreichungsgrades (z.B. Hochmoorregeneration).
Bezeichnung für eine Landwirtschaftsvariante, bei der Böden, Wasserkreisläufe, Vegetation und Produktivität kontinuierlich besser werden. Regenerative Landwirtschaft hat das übergeordnete Ziel, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken entlang der Wertschöpfungskette zu fördern. In diesem dynamischen Konzept werden verschiedene Aktivitäten und Technologien miteinander verknüpft.
Im Zentrum der Betrachtungen steht dabei die Einbettung von Maßnahmen rund um das Thema Klimaschutz und Bodengesundheit (Förderung humusbildender Prozesse und Aktivierung der Bodenbiologie), in einem ganzheitlichen Agrarökosystem. Weitere Aspekte darin sind die Erbringung von Ökosystem-Dienstleistungen, Erhöhung der Biodiversität, Wasserqualität und das Schließen von Nährstoffkreisläufen. Der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und zugekauften Düngemitteln soll weitgehend oder ganz reduziert werden.
Im Kern geht es bei diesem Ansatz um eine ausgeglichene Balance zwischen Umweltzielen und produktiver Landwirtschaft. Eine verbindliche Definition für diese Produktionsweise gibt es nicht und kann es vielleicht auch nie geben.
Erklärtes Ziel der Regenerativen Landwirtschaft ist ein konsequenter Bodenschutz, Verminderung von Nährstoffverlusten und Verringerung des Einsatzes externer Betriebsmittel. In der Wissenschaft wird intensiv diskutiert, ob die Regenerative Landwirtschaft ein Modell zur Umsetzung der Farm-to-Fork-Strategie der EU sein könnte. Daneben beginnen weitere Elemente der 'Lebensmittelkette' (Konzerne des vor- und nachgelagerten Bereiches), Regenerative Landwirtschaft als zukunftsfähiges und nachhaltiges Geschäftsmodell zu etablieren.
Entsprechend ist es durchaus wünschenswert, einige der propagierten Elemente wie den konsequenteren Zwischenfruchtanbau, eine verringerte Bodenbearbeitungsintensität, die Integration der Tierhaltung oder die Ausweitung von Fruchtfolgen zu stärken. Diese Elemente sowie die Untergrundlockerung haben eine solide wissenschaftliche Basis. Wenn es gelingt, diese Elemente mit Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung (z. B. Anbau von Leguminosen und Mischkulturen, blühende Untersaaten, Hecken, Blühstreifen, Dauerkulturen) und einer gewissen Mäßigung im Betriebsmitteleinsatz zu verbinden, entstehen nachhaltige, ressourceneffiziente Anbausysteme mit einem hohen Bodenschutzstandard. Der Betriebsleiter muss allerdings bereit sein, auf Maximalerträge zu verzichten.
Weitere Informationen:
Auch cloud seeding; dabei werden vom Flugzeug aus Silberjodidkristalle oder Kohlensäureschneekristalle in bereits vorhandene Wolken gestreut. An ihnen können die Wassertröpfchen der Wolke anfrieren, so dass größere Eispartikel entstehen, die beim Ausfallen eine Chance haben, als Regen den Erdboden zu erreichen. Man rechnet nur bei der Hälfte der Einsätze mit tatsächlichem Regeneintritt.
Die Anwendung des Verfahrens ist besonders in den ausgedehnten Halbtrockengebieten der Erde, z.B. im Mittelwesten der USA, in Kalifornien, in Israel oder der Pampa Argentiniens sinnvoll. In diesen Regionen kommt es bei sommerlicher Einstrahlung zwar zur Bildung von Konvektionswolken, doch nicht zu Regen. In den Schönwetterkumuli bleiben die Wolkentröpfchen so klein, dass sie vom Aufwind in der Schwebe gehalten werden, oder beim Ausfallen in der ungesättigten Luft unter der Wolke restlos verdunsten.
Im Gegensatz zum Bewässerungsfeldbau die Form des Ackerbaus, bei welcher der zur Verfügung stehende Niederschlag alleiniger Feuchtigkeitsspender für das Wachstum der angebauten Feldfrüchte ist. Die Grenze des Regenfeldbaus ist die Trockengrenze des Anbaus. Diese kann durch extensivere Anbaumethoden, z.B. durch dry farming in Richtung der Trockengebiete verschoben werden.
Unter den Regenfeldbau fallen alle Fruchtfolgen und Brachflächen, die nicht dauernd bewässert werden. Typische Nutzpflanzen für die regenabhängige Fruchtfolge sind Getreide, Gemüse, Viehfutterpflanzen und Wurzelgemüse.
Beim Regenfeldbau ist je nach jährlicher Niederschlags- und Temperaturverteilung zwischen Dauerfeldbau (ganzjähriges Pflanzenwachstum, mehrere Ernten pro Jahr, Immerfeuchte Subtropen) und Jahreszeitenfeldbau zu unterscheiden. Der Jahreszeitenfeldbau wird weiter in den Regenzeitfeldbau (gleichbedeutend mit Trockenfeldbau, Wechselfeuchte Tropen ), in den Sommerfeldbau (Kälteruhe im Winter, gemäßigte Breiten), in Winterfeldbau (Trockenruhe im Sommer, sommertrockene Subtropen) und in das Trockenfarmsystem (Dry Farming) unterteilt.
Die Flächen des Regenfeldbaus blieben von 1961 bis 2008 nahezu gleich, mit einem leichten Trend zur Abnahme. Gleichzeitig stieg der Umfang an Bewässerungsflächen an.
Regenmenge in mm (= l je m²), die in einer festgelegten Zeit versickert bzw. gespeichert werden kann.
Bezeichnung für Wälder, die durch ein besonders feuchtes Klima aufgrund von meist mehr als 2000 mm Niederschlag im Jahresmittel gekennzeichnet sind (zum Vergleich: Das Flächenmittel für Deutschland betrug 2019 nur 735 mm Niederschlag). Wegen der markant unterschiedlichen Klimabedingungen unterscheidet man gemäß der Klimazonen zwischen den Regenwäldern der Tropen (die in wenigen Regionen in subtropische Regenwälder übergehen) und jenen der Gemäßigten Breiten. Im weiteren Sinne werden mitunter auch die Feuchtwälder der Tropen und Subtropen als Regenwälder behandelt.
Demnach ist der Begriff weder physiologisch noch physiognomisch eindeutig definiert. Neben den tropischen Regenwäldern gibt es in der Literatur Regenwälder an der Pazifikküste Nordamerikas, an der Westküste Chiles (z. B. den Valdivianischen Regenwald") und Neuseelands sowie verschiedene Regenwälder in humid Gebirgen (wie in Tasmanien). Außer, dass es dort viel regnet, haben diese Wälder strukturell und ökologisch wenig gemeinsam.
Weitere Informationen:
Regenwürmer (Lumbricidae) gehören zum Stamm der Ringel- bzw. Gliederwürmer (Annelida) und gelten als Nützlinge. Eine der größten und häufigsten einheimischen Arten ist der gemeine Regenwurm oder Tauwurm (Lumbricus terrestris). Er wird 9-15 cm lang (in Ausnahmefällen bis 30 cm) und bis zu 1 cm dick. Weltweit waren 2008 etwa 670 Arten der Regenwürmer (der Familie Lumbricidae) bekannt.
Regenwürmer ernähren sich von abgestorbenen, verfaulten Pflanzenteilen. Diese werden bei der Passage durch den Verdauungstrakt zu Kothumus verarbeitet und in kleinen Haufen meist an den Öffnungen der Gänge ausgeschieden. Besonders in der Nacht ziehen Regenwürmer abgefallene Blätter von der Erdoberfläche in ihre Wohnröhren, wodurch der Prozess der Verrottung beschleunigt wird. Durch das Graben wird der Boden durchmischt, gelockert und belüftet. Das Eindringen von Regenwasser wird dadurch erleichtert. So ist die Bodenfruchtbarkeit unserer Ökosystem wesentlich von der Tätigkeit der Regenwürmer abhängig.
Pro Hektar finden sich in einem gut bewirtschafteten Acker in der biologische Landwirtschaft eine bis drei Millionen Regenwürmer. Zusammen wiegen sie rund 1,4 Tonnen – etwa so viel wie zwei Kühe.
Weitere Informationen:
Übergeordnete, überörtliche und zusammenfassende Planung für das Gebiet einer Planungsregion.
Als „Regionalvermarktung“ ist eine an regionale Merkmale und regional definierte Qualitäten geknüpfte Angebotspolitik zu verstehen für Produkte wie z.B. Agrarprodukte, Holz, Lebensmittel oder auch touristische Leistungen innerhalb einer definierten Region.
Die Begriffe „Region“ oder „von hier“ sind gesetzlich nicht geschützt und werden von Produzenten und Verbrauchern unterschiedlich interpretiert und verwendet. Auch existiert weder in der Praxis noch in der Literatur eine einheitliche Definition der Begriffe.
Regionen können sich geographisch definieren, gleichzeitig aber auch historisch-kulturell oder politisch-administrativ. Hinzu kommen unterschiedliche Vorstellungen von Regionalität. Verbraucherbefragungen zeigen, dass zum Beispiel in kleinstrukturierten Regionen Süddeutschlands regionale Herkunft sehr viel kleinräumiger beschrieben wird als beispielsweise in Norddeutschland.
Die Anbieter können selbst bestimmen, wie groß „ihre“ Region ist, und dürfen mit eigenen Marken oder Siegeln für ihre Produkte werben. Weil es inzwischen eine unüberschaubare Anzahl an regionalen Herkunftskennzeichnungen gibt und die Kriterien für ihre Vergabe zum Teil sehr unterschiedlich sind, sorgen die Siegel häufig für mehr Unsicherheit statt für Transparenz.
Einzelne Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels bestimmen die regionale Herkunft ihrer Produkte dadurch, dass zuliefernde Erzeugerbetriebe in einem bestimmten Radius (meist 30 bis 50 Kilometer) um den jeweiligen Markt lokalisiert sind. Andere Handelsketten weiten die regionale Herkunft auf Deutschland aus, teilweise wird Österreich einbezogen oder gar der gesamte deutschsprachige Raum.
Um dem Fehlen einer belastbaren gesetzlichen Definition und der Heterogenität der Verbraucherdefinitionen gerecht zu werden, bietet sich im digitalen Zeitalter die Blockchain-Technologie an. Mithilfe einer lückenlosen Rückverfolgbarkeit, personalisierten und voreingestellten Präferenzen können Verbraucher QR-Codes auf der Verpackung mithilfe von Smartphone-Apps oder Terminals im Einzelhandel prüfen. Bei weiterverarbeiteten Produkten lässt sich beispielsweise die Länge des Transportwegs nach prozentualer Berechnung der einzelnen Zutaten ermitteln. Es können Synergien mit bestehenden Warenwirtschaftssystemen entlang der Versorgungskette geschaffen werden, wenn etwa Erzeuger, Verarbeiter und Händler ihre Daten digitalisieren und diese wiederum mit Daten aus weiteren Datenbanken mit Produktinformationen ergänzt werden. Um diese Informationen flächendeckend zwischen verschiedenen Herstellern und Zulieferern übertragen zu können, müssen allerdings einheitliche Standards und Schnittstellen geschaffen werden. Damit können der Lebensmitteleinzelhandel und Produzenten das Fehlen der gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien als Chance wahrnehmen und dem Verbraucher mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien begegnen.
Nähe ist nicht alles. Ein weiterer Faktor, der für die Käufer von regionalen Lebensmitteln eine wichtige Rolle spielt, ist die Art und Weise der Erzeugung: Die Mehrheit der deutschen Verbraucher (72 Prozent) wünscht sich eine sozial und ökologisch verantwortungsvolle Herstellung. Das kann bei einzelnen regionalen Produkten auch bedeuten, dass ihre Umweltbilanz schlechter aussieht als die von importierter Ware. Das spielt vor allem bei saisonalen Produkten eine Rolle, bei denen sich beispielsweise die Treibhausgasemissionen eines langen Transportweges durch große Transportvolumina ausgleichen. Um Transparenz zu schaffen, ist es daher wichtig, nicht nur die Herkunft der Rohstoffe, sondern auch die Verarbeitungsbedingungen und den Sitz des Unternehmens aktiv zu kommunizieren.
Ein zentraler Punkt bei der noch ausbaufähigen Regionalvermarktung sind die fehlenden Vermarktungsstrukturen für Lebensmittel aus der Region. Anders als bei Bio-Produkten gibt es noch kaum Kooperationen oder Partnerschaften zwischen den regionalen Erzeugern und dem Handel, sodass Beschaffungs- und Absatzstrukturen erst geschaffen werden müssten.
Weitere Informationen:
Der Regosol (von griechisch „rhegos“ = Decke oder bedecken) ist ein Boden mit Ah/ilC-Profil aus carbonatfreiem oder carbonatarmem (<2 Masse-%) Kiesel oder Silikatlockergestein (Sand) ohne Andeutung eines Bv-Horizontes. Der Bodentyp weist zwei Horizonte auf und wird in der deutschen Bodensystematik in die Klasse R (Ah/C-Böden) eingeteilt.
Sand ist das klassische Ausgangsmaterial für Regosole, da andere kalkarme bis kalkfreie Lockermaterialien (< 2 % CaCO3) äußerst rar sind. Wenn dieser an der Oberfläche ansteht, so liegt vorerst nur ein Horizont („reiner Sand“) vor. Sobald sich eine Besiedlung mit Pflanzen einstellt, kommt es zur Bildung von Humus, so dass sich an der Oberfläche ein zweiter Horizont („humoser Sand“) bildet. Dieses Anfangsstadium wird als Lockersyrosem bezeichnet. Sobald der humose Horizont eine Mächtigkeit von über 2 cm erreicht, ist der Boden ein Regosol. Damit ist die Bodenentwicklung aber nicht abgeschlossen. Im weiteren Verlauf kommt es durch die Verwitterung zur Verbraunung und Verlehmung, so dass sich ein B-Horizont bildet und das Folgestadium erreicht wird (nährstoffarme Braunerde). Am Ende der Bodenentwicklung steht der Podsol.
In Mitteleuropa kommen Regosole nur auf jungen Oberflächen vor, da sie sich im Zug der Bodenentwicklung relativ schnell zu Braunerden und Podsolen weiterentwickeln. Längerfristige oder gar dauerhafte Regosole gibt es nur auf erosionsanfälligen Standorten. Das sind in erster Linie Küstendünen im Stadium der Graudüne. Darüber hinaus sind Regosole heutzutage aufgrund menschlicher Tätigkeit allgemein weit verbreitet. In erster Linie auf erodierten Flächen durch unangepasste Nutzung. Auch Materialverlagerungen im Zuge des Tiefbaus oder Truppenübungsplätze mit sandigem Untergrund können genannt werden. Weltweit sind Regosole in Trockengebieten mit sandigen Wüsten und Halbwüsten weit verbreitet. Dort sind sie wegen der geringen Biomasseproduktion und der ständigen Winderosion auch häufig das Endstadium der Bodenbildung.
Der Regosol besitzt laut Deutscher Bodensystematik die Horizontabfolge Ah/ilC.
Ah: Der Oberbodenhorizont (A) ist humos (h). Er besitzt eine Mächtigkeit von mindestens 2 cm und maximal 40 cm (durchschnittlich 10–20 cm). Der A-Horizont geht direkt in ein Lockergestein über. Unter landwirtschaftlicher Nutzung kann auch die Bezeichnung Ap (p = gepflügt) vorkommen.
ilC: Das Ausgangsmaterial (C) ist locker (l) und kalkarm bis kalkfrei (i = silikatisch; ≤ 2 Gew.% Kalk). In der Regel handelt es sich um Sand (z. B. Flug-, Geschiebesand). Das Material ist weitgehend unverwittert und muss eine Mächtigkeit von mindestens 30 cm haben.
Regosol aus glazifluviatilen Sedimenten
(Schweiz, Zentralalpen)
Regosole entwickeln sich aus carbonatfreien oder carbonatarmen Kiesel- oder Silikatlockergesteinen (z. B. Dünensand, Geschiebesand, glazifluviatilen oder fluvioglazialen und glazialen Sedimenten). Aufgrund des vergleichsweise nährstoffarmen Ausgangsgesteins sind Regosole in der Regel nährstoffarm und sauer. Sie eignen sich für den Waldbau und für die landwirtschaftliche Nutzung, wenn ausreichend Düngemittel die Nährstoffarmut ausgleichen.
Quelle: Alexander Stahr
Sand kann kaum Wasser und Nährstoffe speichern. Von daher sind Regosole Risikostandorte für Trockenstress und Nährstoffmangel. Wegen des Einzelkorngefüges von Sand ist das Material sehr erosionsanfällig. Vorteile von Sand sind eine gute Bearbeitbarkeit, Durchwurzelbarkeit, Durchlüftung und Erwärmbarkeit. Der pH-Wert kann stark schwanken. Auf den meisten Sanden sind sie sehr niedrig; nur an Küsten wegen der Muschelschalen sehr hoch. Durch die niedrige Nährstoffhaltefähigkeit von Sand kommt es aber zu einer schnellen Entkalkung, so dass die Werte mit der Zeit sinken. Regosole entwickeln sich unter guten Bedingungen weiter zur Braunerde.
Regosole sind prinzipiell landwirtschaftlich nutzbar. Wegen der Eigenschaften des sandigen Ausgangsmaterials (Nährstoffarmut, niedrige pH-Werte, Erodierbarkeit und geringen Wasserhaltefähigkeit) sind die Ertragserwartungen aber gering und unsicher. Im Anbau befinden sich Kulturen mit geringen Ansprüchen (Roggen), solche die lockere, warme Böden bevorzugen (Spargel, Kartoffeln) oder Generalisten (Mais).
Mögliche Maßnahmen zur besseren Ackernutzung sind z. B. Bewässerung, regelmäßige und angepasste Düngung oder Humusanreicherung durch organische Düngung (Verbesserung der Haltekapazität von Nährstoffen und Wasser). Insbesondere der Erosionsschutz muss beachtet werden, vor allem wenn der vorliegende Regosol erst durch Erosion entstanden ist.
Sandböden werden in Mitteleuropa oft forstwirtschaftlich genutzt (Kiefern). In den Dünengebieten der Küsten ist eine landwirtschaftliche Nutzung weder möglich noch zweckmäßig. Der Dünengürtel ist wichtig für Natur- und Küstenschutz.
Wiederherstellung von bestimmten Ökosystemfunktionen (einschließlich best. ökologischer Prozesse) bzw. Ökosystemleistungen gemäß eines historischen Referenzzustandes (z.B. Wiederververnässung eines degradierten Hochmoores, Wiederherstellung der Fließgewässerdynamik).
Siehe Bodenbewertung
Bezeichnung für eine lineare Siedlung mit lockerer Reihung von Höfen. Dabei folgt die Gehöftreihung direkt oder parallel einer natürlichen oder künstlichen Leitlinie. Als Leitlinien dieser meist durch gelenkte Waldrodung und Neulandgewinnung entstehenden Ortsform dienen Deiche, Uferdämme, Kanäle und Wege. Hinter den aufgereihten Höfen liegen die meist langen Parzellen (Hufen) rechtwinklig zur Siedlungsachse und reichen oft bis zur Gemarkungsgrenze. In waldreichen Gebieten, vor allem der Mittelgebirge, enstanden die Waldhufendörfer. Marschhufendörfer wurden angelegt im Schutze der Deiche und Uferdämme der See- und Flussmarschen in Niederungsgebieten. Moorhufendörfer entstanden als Siedlungen der Moorkultivierung an geradlinigen Wegen oder Kanälen.
(s. a. Zeilendorf, Straßendorf)
Haltungsform in der Tierproduktion, die häufig bei der Mast von Schweinen, Bullen oder Geflügel angewendet wird. Dabei sind alle Tiere beim Aufstallen ungefähr gleich alt und gleich schwer, erreichen etwa gleichzeitig das angestrebte Produktionsziel und verlassen somit gemeinsam den Stall wieder, z.B. zum Schlachten. Nach gründlichen Maßnahmen zur Stallhygiene erfolgt die Neubelegung mit einem ganzen, geschlossenen Bestand.
Dem Rein-Raus-Verfahren steht als gegensätzliche Methode das kontinuierliche Verfahren gegenüber, bei dem sich in einem Stall Tiergruppen verschiedener Mastabschnitte befinden und die Zu- und Abgänge laufend erfolgen.
Eine Flurform, bei der ein Parzellentyp vorherrschend ist.
Roheinkommen minus Lohnanspruch der familieneigenen Arbeitskräfte = Verzinsung des Aktivkapitals plus Unternehmergewinn.
Der Anbau von nur einer Kulturpflanzenart, bezogen auf eine bestimmte Fruchtfolge oder in Form einer Monokultur.
Aussaat einer einzigen Pflanzenart im Unterschied zur Gemengesaat.
Bezeichnung für die Getreidekörner der Pflanzenarten Oryza sativa und Oryza glaberrima. Oryza sativa wird weltweit in vielen Ländern angebaut, Oryza glaberrima (auch „afrikanischer Reis“ genannt) in Westafrika. Zur Gattung Reis (Oryza) gehören außer diesen beiden Reispflanzen noch wenigstens weitere 17 Arten, die aber nicht domestiziert wurden.
Die neue Hybrid-Sorte Nerica (New Rice for Africa, "Neuer Reis für Afrika") verbindet die Vorteile der beiden Kulturreispflanzen.
Von Oryza sativa gibt es mittlerweile über 120.000 Sorten, die ihn befähigen, sowohl in Höhen von 2000 Metern über NN sowie im Sumpf, im Wasser oder in sehr trockenen Gebieten zu gedeihen.
Die Reispflanze gehört wie die anderen Getreidearten zur Familie der Süßgräser. Reis hat kleine Ährchen als Blütenstände, die in der Regel zwei sterile und eine fertile (fruchtbare) Blüte enthalten und in sogenannten Rispen angeordnet sind. Die fertile Blüte wird durch eine Deckspelze geschützt. Reis ist, wie andere Gräser auch, windblütig, d. h. die Übertragung der Pollen erfolgt allein über den Wind. Unser heutiger Kulturreis (Oryza sativa) wird einjährig angebaut. Er wird bis 120 cm hoch, seine Rispen (10 bis 15 pro Pflanze) enthalten bis zu 300 Reiskörner.
Reis gehört heute zu den sieben wichtigsten Getreidearten (neben Weizen, Roggen, Hirse, Hafer, Gerste, Mais) und ist das wichtigste Grundnahrungsmittel für knapp die Hälfte der Weltbevölkerung. Zwar hat Reis eine geringere Anbaufläche als Weizen oder Mais, er ist aber für die menschliche Ernährung wichtiger als diese, da er kaum für andere Zwecke verwendet wird.
Dunkle Getreidekörner, die im Handel und in der Gastronomie als „Wildreis“ bezeichnet werden, gehören botanisch nicht zur Gattung Reis (Oryza), sondern zur Gattung Wasserreis (Zizania).
Etwa 95 Prozent der heutigen Reisproduktion findet in Südostasien (China, Thailand, Indien) statt. In Europa sind es vor allem Italien, Frankreich, Portugal und Spanien, die Reis anbauen. Meist geschieht dies in den Deltas großer Flüsse wie in der Po-Ebene (Norditalien) sowie im Rhône-Delta (Camargue, Frankreich). Weltweit beträgt die Reisproduktion 741,5 Mio t (2014).
Weltweit wird Reis von ca. 144.000 Landwirten, meist Kleinbauern, auf unter einem Hektar angebaut. Allerdings gibt es in den USA und Australien auch sehr große Betriebseinheiten, in denen Reis mit großem Einsatz von moderner Technologie und fossiler Energie angebaut wird.
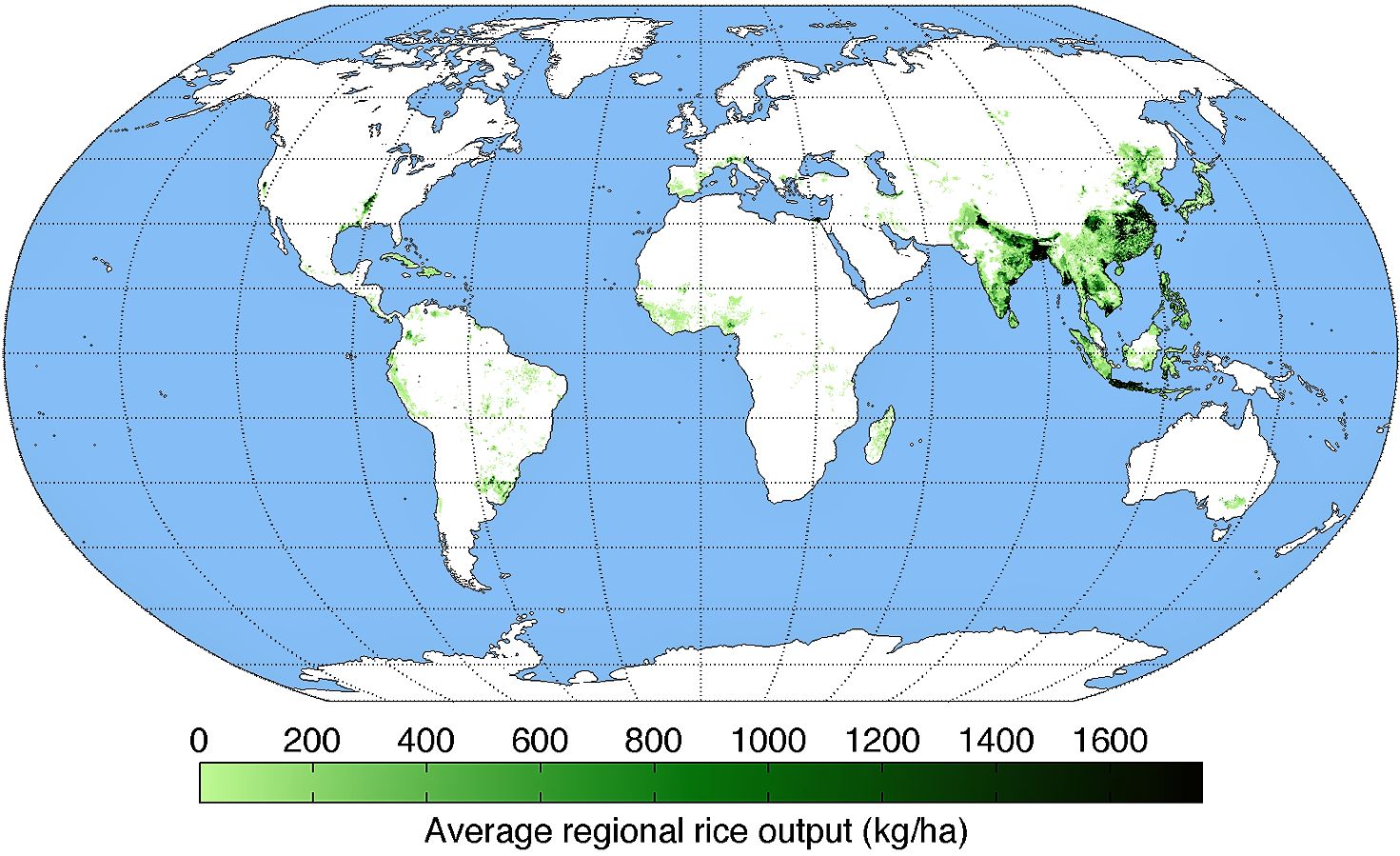
Karte der globalen Reisproduktion (durchschnittlicher prozentualer Anteil der für die Produktion genutzten Fläche mal durchschnittlicher Ertrag in jeder Gitterzelle), zusammengestellt vom Institute on the Environment der University of Minnesota mit Daten aus: Monfreda, C., N. Ramankutty, and J.A. Foley. 2008. Farming the planet: 2. Geographic distribution of crop areas, yields, physiological types, and net primary production in the year 2000. Global Biogeochemical Cycles 22: GB1022
Quelle: Wikimedia Commons
Der heute verwendete Kulturreis Oryza sativa wurde vermutlich im Tal des Yangtze (China) und im Tal des Ganges (Indien) erstmals kultiviert. Vermutlich begannen die Menschen bereits vor etwa 10.000 Jahren (Übergang Pleistozän – Holozän) damit, Reis zu sammeln.
In Japan wurde Reis erst etwa um 300 vor Christus angebaut. Nach Europa kam der Reis durch die Mauren, davor war er um 400 vor Christus ins Zweistromland (Mesopotamien, heute Irak) gelangt. Über Alexander den Großen kam der Reis ans Mittelmeer, wo er zunächst bei Römern und Griechen auf wenig Interesse stieß. Erst in der Renaissance wurde Reis vermehrt verwendet, aus dieser Zeit stammt das berühmte Rezept des „Risotto alla Milanese“ (Reis mit Safran gedünstet).
Nassreisanbau
Reis ist ein Gras, das unter natürlichen Bedingungen in feuchtwarmen Regionen wächst. Um Schädlinge sowie Unkraut am Wachstum zu hindern, hat sich seit etwa 3000 v. Chr. der Nassreis(an)bau entwickelt. Obwohl Reis keine Wasserpflanze ist, hat sich die Züchtung über Jahrhunderte hinweg so entwickelt, dass er mit höheren Wasserständen zurechtkommt, indem er ein Belüftungssystem für die Wurzeln (sog. Aerenchym) entwickelte.
Der Anbau erfolgt in folgenden Schritten:
Etwa 75 - 80 Prozent der Reisernte wird in diesem Verfahren durchgeführt. Eine Variante des bewässerten Reises ist der regenbewässerte Reis in Tiefländern, bei dem der Reis nur während einer Periode des Pflanzenwachstums (aber mindestens 10 Tage) unter Wasser steht, dafür aber mit größerer Tiefe. Die Erträge bei regenbewässertem Tieflandanbau (v. a. Thailand, Nepal, Myanmar, Bangladesch) sind weniger als halb so hoch wie bei bewässeretem Reis.
Eine Sonderform des Nassreisanbaus ist der Terrassenfeldbau, bei dem der Nassreisanbau auch an mäßig steilen Berghängen durchgeführt werden kann.
Trockenreisanbau
Hierzu wird eine Unterart des heutigen Reises genutzt, der nicht an Überflutung angepasst ist. Vorteil: Trockenreisanbau kann auch in Gegenden erfolgen, wo der Nassanbau nicht möglich ist, etwa im Gebirge. Allerdings benötigen diese Reissorten eine hohe Luftfeuchtigkeit. Nachteil: Ohne Wasser können Unkräuter ungehemmt wachsen, so dass die Ernte gegenüber dem Nassanbau stark geschmälert wird. Trockenreis wird in der Regel über das Streusaatverfahren ausgebracht und bis in Höhen von 2.000 Metern angewendet. Trockenreis ist teurer, wird aber wegen seines intensiveren Aromas geschätzt. In diesem Verfahren ist der Methanausstoß sehr gering, aber durch die ebenfalls geringeren Erträge stellt der Trockenreisanbau kaum eine Alternative zum Nassreisanbau dar.
Maschinelle Anbauverfahren beinhalten das Ausbringen der Saat per Flugzeug und das Ernten mit dem Mähdrescher. Diese Verfahren werden vor allem in Europa und den USA angewendet. Arbeit von Hand wie in den asiatischen Staaten wäre hier nicht bezahlbar.
Um ein Kilo Reis über das oben genannte Verfahren zu erzeugen, sind zwischen 3.000 und 5.000 Liter fließendes Wasser nötig. Probleme kann es geben, wenn die Bewässerung über Brunnen erfolgt, da sich der Grundwasserspiegel dadurch stark absenkt. Im Umland von Peking ist daher der Reisanbau verboten.
Einfluss auf die Bodenerosion
Der moderne Reis, der für das Nassanbauverfahren ausgelegt ist, benötigt fließendes Wasser, da stagnierendes Wasser zu verstärkter Algenbildung führen würde. Fließt das Wasser zu schnell, wird wertvoller Boden mit weggerissen. Die Fließgeschwindigkeit des Wassers darf also nicht zu langsam und nicht zu schnell sein.
Einfluss auf den Klimawandel
Durch den Nassanbau wird im Boden des Reisfeldes ein anaerobes Milieu erzeugt, das sogenannte Methanogene (Archaebakterien oder Archaea, bei deren Stoffwechsel Methan entsteht) begünstigt. Nach neueren Berechnungen gehen bis zu 25 Prozent der weltweiten Methan-Produktion auf den Nassreisanbau zurück, das sind bis zu 100 Millionen Tonnen pro Jahr. Da ein Methan-Molekül 21 bis 72 Mal (in Abhängigkeit vom betrachteten Zeithorizont) wirksamer ist als ein CO2-Molekül, entspricht das umgerechnet mindestens 300 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr.
Forscher haben festgestellt, dass sich der Methanausstoß verringern lässt, wenn die Felder zwischendurch trockengelegt werden, da die Methanogene keinen Sauerstoff vertragen. Geforscht wird hier an einem Bewässerungssystem, welches die Felder zwischendurch trockenlegt, also die Bewässerung der Felder regelt. Bisher sind die meisten Felder ständig unter Wasser, die Bewässerung kann also oftmals nicht von außen geregelt werden. Auch eine veränderte Düngung sowie spezielle Reissorten können den Methanausstoß verringern.
Die meisten Nährstoffe im Reis stecken in seinem "Mantel", dem sogenannten Silberhäutchen. Es liegt zwischen der Frucht und der schützenden Deckspelze und wird bei den "polierten", also weißen Reissorten, entfernt. Beim Naturreis bleibt es erhalten und gibt ihm seine gelblich-grüne bis braunrote Farbe. Im Korn selbst steckt dagegen eine Menge an sogenannter Reisstärke. Dieses Kohlenhydrat ist vom menschlichen Körper leicht aufzuschließen und ein wertvoller Energielieferant. Dazu kommen wichtige Mineralstoffe wie Kalium und Phosphor. Reis ist ein sehr wertvolles Grundnahrungsmittel, trotzdem fehlen ihm verschiedene Nährstoffe wie Beta-Carotin, Vitamin C, Eisen und Kalzium. Vor allem weißer Reis enthält fast nur noch Stärke und wenig Eiweiß.
Reis wird noch im Ernteland gedroschen und anschließend in die Reismühle eingeliefert. Dort wird der Rohreis (Paddy) in einem mechanischen Verfahren von den Deckspelzen getrennt. Die Spelzen werden häufig zur Energiegewinnung weiterverarbeitet.
Nach den Deckspelzen wird vom Halbrohreis (Vollreis) das Silberhäutchen entfernt. Dies geschieht durch Schleifen (Polieren), da es fest auf dem Keimling aufliegt. Aus dem nährstoffreichen, abgeschliffenen Material wird oftmals Tierfutter hergestellt. Nachdem das Häutchen ab ist, spricht man vom polierten, weißen Reis. Er ist jetzt leicht verdaulich, aber er enthält auch deutlich weniger Mineralstoffe, Vitamine und Ballaststoffe als der Vollreis.
Etwa 95 Prozent der Reisernte gehen in den menschlichen Verzehr, der Rest wird für Futtermittelzwecke und in der Forschung genutzt. Neben der Verwertung des ganzen Korns wird Reis auch zu Reisflocken, Reisnudeln und Reisgebäck weiterverarbeitet. Weitere Verarbeitungsprodukte sind Reisstärke, die in der Industrie für Eiscreme, Pudding und Gel verwendet wird, sowie Reiskleie, die zur Herstellung von Süßwaren dient. Reisöl wird als Speiseöl verwendet, ebenso in Kosmetikprodukten und als industrielles Öl (etwa zur Spülung bei Tiefbohrungen). Reishülsen finden Verwendung als Brennstoff, in der Karton- und Papierherstellung, als Packungs-, Bau- oder Abdichtmaterial.
Dieses Verfahren wurde entwickelt, um beim Reis einen höheren Anteil an gesunden Inhaltsstoffen zu erhalten. Dazu wird der Rohreis unter Vakuum eingeweicht, so dass die Inhaltsstoffe von Keimling, Silberhäutchen und Schale sich lösen. Anschließend werden sie mit Wasserdampf und hohem Druck wieder ins Reiskorn gepresst, so dass der größte Teil der Inhaltsstoffe jetzt im Korn selber steckt. Danach kommt der Reis wie gewohnt in die Mühle, wo das Entfernen von Spelzen und Silberhäutchen jetzt einfacher vonstattengeht. Das Parboiled-Verfahren wird sowohl bei Voll- als auch bei weißem Reis angewandt. Man erkennt ihn daran, dass er im ungekochten Zustand etwas glasig aussieht. Nach dem Kochen verschwindet dieser Eindruck. Das Parboiled-Verfahren wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA entwickelt.
Die Gesamt-Reisproduktion betrug 2008 nach Schätzungen der FAO 685 Millionen Tonnen Rohreis, davon 657 Millionen Tonnen in den Entwicklungsländern und 28 in den Industrieländern. Von diesen 28 Millionen Tonnen stammten 9,3 Millionen Tonnen aus den USA und 2,6 Millionen Tonnen aus der Europäischen Union. Der größte Reisproduzent ist China mit über 193 Millionen Tonnen im Jahr 2008. Darüber hinaus ist Reis kein großes Exportgut: Etwa 95 Prozent des Reises werden dort verbraucht, wo sie angebaut werden. Die wichtigsten Exportländer der Jahre 2013/14 waren Thailand und Indien. In Afrika basieren 40 % des Reiskonsums auf importiertem Reis.
Reis wird nach Bearbeitung in der Reismühle in Säcke verpackt und per Schiff weiter transportiert. Seine Lagerung erfolgt ebenfalls in Säcken, in denen er in vielen Asialäden auch gekauft werden kann.
Da Reis als Grundnahrungsmittel für die Bevölkerung immer größere Bedeutung erlangt, gibt es auch umfangreiche Forschungen, um die Erträge zu sichern und zu steigern. Dem Schutz der Pflanze gegen Krankheiten und Schädlinge widmet die molekularbasierte Pflanzenforschung ein besonderes Augenmerk. Seit 2002 ist das Genom von Reis vollständig entschlüsselt.
Weitere Informationen:
Die morphologische und (boden-)ökologische Eingliederung von devastiertem Gelände in die umgebende Landschaft während und nach einem Eingriff, einschließlich der Begründung angemessener Folgenutzung oder Folgefunktion (z.B. land- und forstwirtschaftlich, im weiteren Sinne auch Naturschutz als Folgenutzung). Dazu dient ein Bündel von geotechnischen, landespflegerischen, wasserbaulichen, agrar- und forstökologischen Maßnahmen. Von Rekultivierungen betroffen sind ehemalige Bergbaugebiete mit ihren Halden und Tagebaulöchern, Steinbrüche, Kiesgruben, Müll- und Schutthalden, Deponien sowie jegliche Zerstörungen von Ökosystemen auf Grund von technischen Eingriffen in die Landschaft.
Bei Abgrabungen oberflächennaher Rohstoffe (Kies, Sand, Ton, Kieselgur, Torf, Braunkohle) wird dem Erhalt der humus- und nährstoffhaltigen, belebten Krume besonderes Augenmerk gewidmet. Die horizontmäßige Zwischenlagerung von Deckböden bei Abgrabungen und ihr anschließend entsprechender Wiedereinbau verfolgt den Zweck, Verhältnisse zu schaffen, die der Umgebung möglichst ähnlich sind.
Rekultivierungen werden heute als Schüttungen oder als Spülversatzflächen erstellt. Bei der Neuanlage muss ein Porensystem erzeugt werden, das die klimabedingt anfallende Wassermenge schnell genug so im Bodenvolumen verteilt, dass die durch Nässe hervorgerufene Stabilitätsminderung nicht zu unerwünschtem Zusammensacken führt. Außerdem muß festgelegt werden, wieviel Wasservorrat im durchwurzelbaren Bereich speicherbar sein muß, damit zu erwartende Trockenperioden nicht die Vegetation schädigen.
Bei der Kiesgewinnung beispielsweise stehen Abbau und Rekultivierung in Deutschland z.Z. im Gleichgewicht, es werden jährlich etwa ebenso viele Hektar rekultiviert wie abgegraben.
(s. a. Renaturierung, Bergbaufolgelandschaft)
Siehe Staffelanbau
Unter Relief (frz. „das Hervorgehobene“) versteht man in der Geomorphologie die Oberflächengestalt der Erde, d. h. die Form des Geländes.
Für die landwirtschaftliche Nutzung relevante Faktoren im Zusammenhang mit dem Relief sind Hangneigung, Hangrichtung (Exposition), Kleinrelief, Talgestaltung, Erosionsgefahr, Massenerhebung u. a.
Ein ausgeprägtes Relief wirkt in der Regel limitierend auf die agrarischen Nutzungsmöglichkeiten. Dies gilt insbesondere für die moderne Landwirtschaft, die für einen optimalen Einsatz der Maschinen vorwiegend ebene Flächen benötigt. Aus diesem Grund wird die Verteilung der jeweils günstigsten Nutzungsformen und die Auswahl der Feldfrüchte u.a. durch den Grad der Maschinisierung beeinflusst, da z.B. der Anbau von Getreide mit Maschineneinsatz bei einer Hangneigung von 12 - 18 % gerade noch möglich, der Anbau von Kartoffeln oder Rüben dagegen schon sehr erschwert ist. Steilere Hanglagen werden dagegen zunehmend als Weide- oder Waldflächen genutzt.
Genau betrachtet wirkt das Relief als Standortfaktor zur Differenzierung verschiedener Nutzungsformen im Gebirge immer im Zusammenwirken mit den höhenabhängigen Klimaelementen Temperatur und Niederschlag sowie den Höhengrenzen der unterschiedlichen Vegetationsformationen.
Formen der agrarischen Nutzungsapassung an die spezifischen Reliefbedingungen von Gebirgen:
Das Ren oder Rentier (Rangifer tarandus) ist eine Säugetierart aus der Familie der Hirsche (Cervidae). Es lebt zirkumpolar im Sommer in den Tundren und im Winter in der Taiga Nordeurasiens und Nordamerikas sowie auf Grönland und anderen arktischen Inseln. Es ist die einzige Hirschart, die domestiziert wurde.
Die nordamerikanischen Vertreter der Rentiere werden als caribou (dt. Karibu) bezeichnet, ein Wort aus der Sprache der Mi’kmaq-Indianer.
Die Größe schwankt sehr mit dem Verbreitungsgebiet. Die Kopfrumpflänge kann 120 bis 220 Zentimeter betragen, die Schulterhöhe 90 bis 140 Zentimeter und das Gewicht 60 bis 300 Kilogramm. Das Fell ist dicht und lang, dunkel-graubraun oder, besonders bei domestizierten Tieren, auch hell; im Winter ist es generell viel heller als im Sommer.
Die Geweihe sind stangenförmig und weit verzweigt; nur die tiefste Sprosse bildet am Ende eine kleine Verbreiterung.
Die Hufe der Rentiere sind sehr breit und durch eine Spannhaut weit spreizbar. Außerdem sind lange Afterklauen ausgebildet. Dies ermöglicht den Tieren im oft steinigen oder schlammigen Gelände sicheren Tritt.
Rentiere zählen zu den am weitesten nördlich lebenden Großsäugern. Sie bewohnen in etwa 20 Unterarten die Tundren und nördlichen Waldgebiete (Taiga) von Europa, Asien und Amerika. Selbst auf hocharktischen Inseln wie Spitzbergen, der Ellesmere-Insel und Grönland kommen Rentiere vor. Um dem arktischen Winter zu entgehen, unternehmen die Renherden große Wanderungen, um ausreichend Nahrung (Gräser, Sträucher, Flechten) zu finden, manche bis zu 5000 Kilometern – die längste regelmäßige Wanderung von Landsäugern überhaupt.
Auf dem europäischen Festland gibt es nur noch in der norwegischen Hardangervidda eine kleine Population des Wildrens. Bei den großen Rentierherden Lapplands und Nordostrusslands handelt es sich ausschließlich um (geringfügig) domestizierte, „halbwilde“ Rentiere, die unter der Obhut z. B. der Samen stehen (die Zuchtwahl bei Rentieren fand und findet im Gegensatz zu anderen Nutztieren nur sehr eingeschränkt statt).
In Nordkanada reicht das Verbreitungsgebiet der Rentiere (Karibus genannt) weiter in den Süden, also in die Boreale Zone.
Schon auf Höhlenzeichnungen der Steinzeit findet man häufig Rener dargestellt. Sie waren schon für die Neandertaler eine begehrte Jagdbeute. Bis heute werden Rentiere in vielen Teilen der Welt gehalten und gejagt, da man ihr meist sehr mageres Wildbret und ihr Fell schätzt. In den Regionen, in denen Großwild, Faserpflanzen und Baustoffe spärlich sind oder fehlen, haben Menschen beinahe jeden Körperteil des Rentiers genutzt: ihre Haut für Pelze und Leder, ihr Blut als Heilmittel („Saina tjalem“), ihr Geweih und ihre Knochen zur Werkzeugherstellung.
Der Beginn der Nutzbarmachung der Rentierherden für die Naturweidewirtschaft liegt etwa 5000 Jahre zurück und fand zuerst in Sibirien statt.
Heutzutage sind es vor allem indigene Völker, deren Lebensweise stark durch das Zusammenleben mit Rentieren geprägt ist. Für die Nenzen in Sibirien beispielsweise ist das Rentier ein bedeutender Bestandteil ihres Lebens und Teil ihrer Lebensgrundlage. Das gilt auch noch für einen kleinen Teil der nordeuropäischen Samen.
Noch heute wird in Lappland und Nordrussland Rentierzucht betrieben (vielfach halbnomadisch). In Norwegen und Schweden ist sie ein Privileg der Samen, in Finnland wird sie hauptsächlich von Finnen ausgeübt. Die Herden können frei umherwandern, die Menschen folgen ihnen. Die Rentiere werden zu festgelegten Zeiten zusammengetrieben, um die Kälber zu markieren oder ausgewählte Tiere zu schlachten. Das Zusammentreiben großer Herden wird heute teilweise mittels Hubschraubern und/oder Motorschlitten erledigt.
In verschiedenen Teilen der Welt ist das Ren durch die Bejagung zwischenzeitlich sehr selten geworden. Heute gibt es weltweit etwa 4 Millionen wilde und 3 Millionen domestizierte Rentiere. Die Art gilt damit nicht als gefährdet. Drei Viertel der wilden Rentiere leben in Nordamerika, und mehr als drei Viertel der domestizierten Rentiere sind in Sibirien beheimatet.
Wildlebende Rentiere gibt es in Europa nur noch im norwegischen Dovrefjell.
Weitere Informationen:
Überführung anthropogen veränderter Lebensräume in einen naturnäheren, ursprünglich vorhandenen Zustand mit der Möglichkeit einer natürlichen, ungestörten Weiterentwicklung. Mit Renaturierung ist keine Rückkehr zu einem wie auch immer gearteten Ur- oder Idealzustand gemeint. Vielmehr geht es darum, den Umgang mit terrestrischen Ökosystemen sinnvoll auszugestalten und in nachhaltigen Grenzen zu halten sowie gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz und Klimaanpassung zu leisten.
Der angestrebte natürliche oder quasinatürliche Zustand (Regeneration) betrifft nicht nur Formenelemente (z.B. Bachmäander), Flora und Fauna, sondern auch den Stoff-, Wasser- und Energiehaushalt der jeweiligen Landschaftsausschnitte. Dazu trägt auch eine geringere Nutzungs- bzw. Eingriffsintensität bei. Bei Aufhören der Nutzung ist dies verbunden mit dem Zulassen der natürlichen Sukzession. Der Begriff "Nutzung" ist dabei weit gefasst und beinhaltet menschliche Einwirkungen aller Art (einschließlich Naturschutzmanagement), nicht nur Landnutzung im konventionellen Sinne. Dies erlaubt eine schrittweise Annäherung an ein vorher bestimmtes Umweltziel (z.B. Renaturierung von Fließgewässern mit entsprechendes Entwicklungszielen, naturnaher Waldumbau, Wiedervernässung von Mooren und Rehabilitation von Graslandökosystemen).
| Passive Renaturierung | Belastungen und Eingriffe werden reduziert, Ökosysteme regenerieren sich von selbst durch natürliche Prozesse wie zum Beispiel Sukzession. |
| Aktive Renaturierung | Wiederherstellung von Ökosystemstrukturen und -funktionen wird aktiv initiiert oder unterstützt. |
| Rekultivierung | Anderweitig genutzte Flächen (z. B. Bergbau) werden für Landwirtschaft, Waldbewirtschaftung oder Freizeitnutzung wieder nutzbar gemacht. |
| Revitalisierung | Bestimmte abiotische Standortfaktoren und Ökosystemfunktionen werden wiederhergestellt. |
| Ökologische Sanierung | Starke Umweltbelastungen werden zur Verbesserung der abiotischen Bedingungen aktiv beseitigt. |
Die Degradierung von Ökosystemen ist das Ergebnis der Nutzungsformen, Landnutzungsänderungen bzw. Intensivierung in Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei sowie der Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche. Diese direkt landnutzungsbedingten Faktoren werden verstärkt durch Eutrophierung, Schadstoffeinträge, invasive Arten und Klimawandel. Die Folgen sind gravierend – auch für uns Menschen. Geschädigte Ökosysteme können viele ihrer Leistungen nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr erbringen, beispielsweise die Lebensmittelproduktion, die Kohlenstoffspeicherung oder die Regulierung des Wasserhaushalts.
Auch können sie Störungen, etwa durch Waldbrände oder die Einwanderung gebietsfremder Arten, weniger gut abpuffern. Klimawandelbedingte Extremereignisse, beispielsweise Dürren oder Starkregen, erhöhen diese Risiken. Renaturierungsmaßnahmen sind daher dringend notwendig, um die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen zu fördern und Synergien mit Klimaschutz und -anpassung zu schaffen. Dies gilt innerhalb und außerhalb von Schutzgebieten und sogar auch für naturferne Ökosysteme wie Ackerflächen oder Stadtparks. In der Regel müssen sich dafür die Praktiken der Flächennutzung verändern. Nicht immer erfordert Renaturierung allerdings, den menschlichen Einfluss zu reduzieren oder sogar zu minimieren, oftmals sichert gerade eine bestimmte, naturverträgliche Art von Bewirtschaftung vielfältige Ökosysteme. (SRU 2024)
Eine Renaturierungspolitik, die einen erhöhten Import von nicht nachhaltig erzeugten land- und forstwirtschaftlichen Produkten nach sich zieht, würde den ökologischen Fußabdruck Deutschlands in der Welt erhöhen. Renaturierungserfolge im Inland würden somit durch größere Umweltschäden im Ausland erkauft. Dies erfordert, parallel zur Verbesserung heimischer Ökosysteme generell den Nutzungsdruck auf Flächen zu verringern. Hierfür sind Maßnahmen in verschiedenen Sektoren erforderlich: Im Ernährungssektor muss die tierbasierte Ernährung und in der Folge die Nutztierhaltung schrittweise, aber im Ergebnis erheblich, verringert werden, da die dafür erforderliche Produktion von Futtermitteln sehr flächenintensiv ist.
Renaturierung kann im erforderlichen Maßstab nur gelingen, wenn Maßnahmen in Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren vor Ort und der Öffentlichkeit partnerschaftlich entwickelt und umgesetzt werden. Es gilt, regionalökonomische Chancen einer Renaturierungswirtschaft zu nutzen und zu kommunizieren. Landwirtschaft und Forstwirtschaft sollten beim Umstieg auf veränderte Landnutzungsformen unterstützt werden.
Zwei Missverständnisse gilt es hinsichtlich der Renaturierung von Ökosystemen auszuräumen. Erstens ist das Ziel von Renaturierungsmaßnahmen nicht, einen Naturzustand frei von menschlichem Einfluss wiederherzustellen, der in Mitteleuropa ohnehin seit langem praktisch nicht mehr anzutreffen ist. Zwar ist die intensive Landnutzung eine der Hauptursachen für den Verlust von Biodiversität, allerdings kann extensive Nutzung durch den Menschen vielfach auch die Biodiversität fördern: So wurden in Europa viele artenreiche Kulturlandschaften wie Wiesen, Weiden und Heiden vom Menschen geschaffen und genutzt. Zahlreiche der in ihnen lebenden Tiere und Pflanzen profitieren von einer extensiven Bewirtschaftung und Pflege dieser Flächen oder sind sogar davon abhängig. Zweitens bedeutet Renaturierung nicht, dass ein statisch definierter Zielzustand erreicht werden soll. Menschliche Aktivitäten und Umweltveränderungen werden auch zukünftig erhebliche Auswirkungen auf Ökosysteme haben.
Weil die Natur vielfach bereits in einem schlechten Zustand ist, gewinnt das Anliegen der Renaturierung immer mehr an Relevanz. So haben die Vereinten Nationen die Jahre 2021 bis 2030 zur „UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen“ ausgerufen. Mit Blick darauf hat die Europäische Union eine Verordnung zur Wiederherstellung der Natur erarbeitet.
Mit der EU-Verordnung zur Wiederherstellung degradierter Ökosysteme sollen die Leistungen, die eine intakte Natur für die Menschen erbringt, erhalten werden – fruchtbare Böden, Trinkwasserversorgung, Bestäubung, Schutz vor Naturgefahren sowie Freizeit und Erholung. Letztendlich geht es darum, die vom Menschen versursachten Schäden an der Natur zu reparieren und damit unsere Lebensgrundlage zu bewahren. Die Verordnung sieht vor, dass die Mitgliedstaaten hierzu Wiederherstellungspläne erstellen.
(s. a. Rekultivierung)
Weitere Informationen:
Die Rendzina ist ein Boden aus festem oder lockerem Carbonat- (Kalkstein, Dolomit) oder Gipsgestein. Der Name des Bodens stammt von polnischen Bauern. Rendzina bedeutet soviel wie „Kratzer“ und verdeutlicht das scharrende Geräusch des Pfluges an den vielen Steinen im Boden. Die Normrendzina besitzt ein Ah/cC-Profil (c für carbonatisch), wobei die Basensättigung des Oberbodens bei ≥50 % liegt. Die Humusform ist häufig Mull.
Der Oberboden oder Ah-Horizont ist meist gut durchwurzelt und weißt ein stabiles Krümelgefüge auf. Bei ausreichend Niederschlag wird der gelöste Kalk oder Gips mit dem Sickerwasser bis in das Ausgangsgestein ausgewaschen. Zurück bleibt ein unlösbarer Rückstand aus Ton und Quarzkörnern, der sozusagen als „Verunreinigung“ im Gestein enthalten ist. Rendzinen sind ein häufiger Bodentyp in den Nördlichen und Südlichen Kalkalpen (z. B. Wettersteingebirge, Karwendelgebirge, Berchtesgadener Alpen, Dolomiten) oder auf der Schwäbischen Alb.

Rendzinen sind verbreitet in den Nördlichen und Südlichen Kalkalpen (z. B. Wettersteingebirge, Karwendelgebirge, Berchtesgadener Alpen, Dolomiten), auch auf der Schäbischen Alb.
Quelle: Alexander Stahr
Der Boden hat einen günstigen Luft- und Wasserhaushalt und besitzt meist eine hohe Austauschkapazität für Nährstoff-Ionen. Da Rendzinen nicht sehr tief entwickelt sind, können sie mit dem Pflug nur sehr oberflächlich bearbeiten werden. Aus diesem Grund werden Rendzinen eher als Weiden oder auch als Hutung oder Forst genutzt. Umso wertvoller sind sie dafür als Standorte für seltene Pflanzen und Tiere.
Doch übermäßige Beweidung führt rasch zur Bodenerosion und Freilegung des anstehenden Gesteins. Erst nach sehr langer Zeit kann sich bei einer Rendzina ein verbraunter Bv-Horizont ausbilden. Dabei entwickelt sich in Mitteleuropa allmählich ein neuer Boden, eine Terra fusca (Kalksteinbraunlehm).
Unter südeuropäischem Klima (Mittelmeerraum) entwickelt sich aus der Rendzina die Terra rossa (Roterde). Rot deshalb, weil sich unter den mediterranen Bedingungen bei der Bodenentwicklung das rot färbende Eisenoxid Hämatit (Fe2O3) bildet (von griech. „haimatoeis“ = blutig). (ahabc.de)
Weitere Informationen:
Versuche der Erschließung, Sicherung oder Verbesserung von Chancen zur Erzielung von Einkommen im Marktbereich mit Hilfe politisch erwirkter Privilegien. Das Ziel ist eine dauerhafte Geldleistung (Rente) im Marktbereich. Als Beispiel gilt die Errichtung und Erhaltung von Zollschranken auf Betreiben inländischer Produzenten.
Wirtschafts- und Sozialsystem, das im Orient spätestens 2.000 v. Chr. entstand und sich in vielen Entwicklungsländern in mehr oder weniger charakteristischer Form bis heute erhalten hat.
Die Eigentumsverhältnisse weisen die rentenkapitalistisch orientierten Verpächter als Groß(grund)eigentümer aus. Da ihre Lebensform keine Beziehung zum Agrarsektor erkennen läßt, sind sie nicht als Großagrarier oder Großgrundbesitzer zu bezeichnen, da diese Begriffe eine mitverantwortliche Leitung bei der Landnutzung beinhalten. Der Rentenkapitalismus ist in einigen Entwicklungsländern auf revolutionärem oder evolutionärem Wege beseitigt, besteht aber in anderen noch. Für eine soziale und wirtschaftliche Weiterentwicklung stellt er ein schweres Hindernis dar.
Extensive Weidewirtschaft einheimischer Völker - Samen (Lappen), Nenzen u.a. - mit Rentieren in der Waldtundra und Tundra Nordeuropas und Sibiriens. Saisonale Wanderungen führen die hirschähnlichen Tiere im Sommer in die Tundra oder Höhentundra, im Winter in Schutz und Nahrung (Rentierflechte) bietende Wälder. Das Management der Herden ist teils hochentwickelt, teils noch traditionell und dann weitgehend auf Selbstversorgung ausgerichtet. Die winterliche Überwachung der Herden wird inzwischen weithin mit Hilfe von Motorschlitten vorgenommen. Erschließungsmaßnahmen unterschiedlichster Art beeinträchtigen diese Wirtschaftsweise.
In Nordeuropa ist die (halb-)nomadische Rentierwirtschaft mit staatlicher Hilfe weitgehend einer stationären Form gewichen. Versuche, die Rentierhaltung in Nordamerika einzuführen misslangen wegen des Desinteresses der Eskimos. Mehr Hoffnung richtet sich auf die Nutzung des heimischen, nichtdomestizierten Karibus in Form eines game ranching.
Reptation ist ein äolischer Prozess, der die rollende und kriechende Bewegung von Körnern auf der Bodenoberfläche beschreibt. Dieser wird durch Winddruck sowie durch den Impuls beim Einschlag saltierender Körner (Saltation) ausgelöst. Reptation führt i.d.R. zu kleinräumiger Akkumulation der so bewegten Körner.
Die nötige Bewegungsenergie stammt von in Saltation transportierten, kleineren Sandkörnern und wird durch deren fortwährenden Aufprall auf die liegenden Körner übertragen, die für den Saltationstransport zu groß bzw. zu schwer sind.
Reptation ist maßgeblich an der Bildung von Windrippeln beteiligt. Die transportierte Korngröße ist von der Windgeschwindigkeit abhängig, wobei die Obergrenze für Reptation mit Akkumulation mit 2-4 mm angegeben wird. Gröbere Körner werden bei Starkwind zwar verlagert, akkumulieren aber nicht mehr.
Ganz allgemein bezieht sich Resilienz auf die Fähigkeit, sich trotz widriger Umstände positiv zu entwickeln. Ein resilienter landwirtschaftlicher Betrieb oder eine resiliente Region zeigt folgende Eigenschaften:
Resilienz - Definition der Welthungerhilfe
Welthungerhilfe definiert Resilienz als die Fähigkeit von Personen, Gemeinden oder Institutionen, sich von extremen Belastungen rasch zu erholen und Strategien zu entwickeln, mit wiederkehrenden Herausforderungen umzugehen. Sie arbeitet auf zwei Ebenen: Ursachen – wenn möglich – bekämpfen, und die Widerstandskraft der betroffenen Bevölkerung stärken.
Quelle: Welthungerhilfe 2021
Weitere Informationen:
Allgemein die Widerstandskraft eines Organismus gegen äußere Einflüsse. Beispielsweise bezeichnet der Begriff die Eigenschaften und Fähigkeiten einer Pflanze, sich pathogener Einwirkungen einer Infektion teilweise oder ganz zu erwehren.
Auch bezieht sich der Begriff auf die verlorene Wirksamkeit von früher wirksamen Pflanzenschutzmitteln bei vielen Unkräutern, Pilzen oder sonstigen Schädlingen. Die Pflanzen haben Mechanismen entwickelt, mit den für sie schädlichen Substanzen zu leben.
Dabei wird im Wesentlichen zwischen zwei Arten von Resistenz unterschieden:
Medizinisch können bakterielle Krankheitserreger gegen Antibiotika Resistenzen entwickeln (Antibiotikaresistenz). Die Medikamente werden dann unwirksam gegen die zu behandelnde Krankheit.
Zwischen Kulturpflanzen und Unkräutern besteht eine interspezifische Konkurrenz um Ressourcen (Licht, Nährstoffe, Wasser) auf der die Schadwirkung der Unkräuter beruht. Dadurch werden Wachstum und Entwicklung der Kulturpflanzen und im Ergebnis deren Ertragsleistungen nachteilig beeinflusst.
Lichtmangel führt zu geringeren Photosyntheseleistungen und damit zu einer verringerten Nettoprimärproduktion. In Agrarökosystemen werden die höchsten durch Lichtkonkurrenz bedingten Agrarverluste von Unkräutern verursacht, die in der Lage sind, Kultupflanzen auf Grund einer hohen relativen Wachstumsrate zu übergipfeln und so zu beschatten. Umgekehrt bewirkt auch eine Beschattung durch Kulturpflanzen eine Unterdrückung des Aufwuchses von Unkräutern.
Die Konkurrenz von Pflanzen um Nährstoffe wird in Agrarökosystemen nicht nur von der natürlichen Bodenfruchtbarkeit, sondern auch durch Düngung bestimmt. Ob und in welcher Weise die Konkurrenzverhältnisse zwischen Kultur- und Ackerbegleitpflanzen durch diesen Faktor beeinflusst werden, hängt nicht nur von der ausgebrachten Düngermenge und der Bestandesdichte ab, sondern auch von den Eigenschaften der jeweiligen Arten. Nicht alle Pflanzenarten sind gleichermaßen in der Lage, ein hohes Nährstoffangebot effizient zu nutzen.
Die Bedeutung von Wasser als Konkurrenzfaktor in Agrarökosystemen wird wesentlich von der Menge und der Verteilung der Niederschläge in der Anbauperiode bestimmt. Weitere wichtige Faktoren sind die Wasserspeicherfähigkeit der Böden und die Fähigkeit der Pflanzen, das vorhandene Wasser zu nutzen. Arten, die ein großes Wurzelnetz oder Pfahlwurzeln besitzen, können Wasser aus größerer Tiefe beziehen als solche, die nur ein flaches Wurzelsystem ausbilden. Dies ist vornehmlich dann ein Vorteil, wenn die oberen Bodenbereiche witterungsbedingt austrocknen. Vor allem junge Kulturpflanzen, die wegen ihres noch schwach ausgebildeten Wurzelsystems auf oberflächennahes Wasser angewiesen sind, haben in einer solchen Situation gegenüber tief wurzelnden Unkrautarten.
Schließlich darf nicht übersehen werden, dass die Wirkungen, die bei der Konkurrenz von Kultur- und Ackerbegleitpflanzen auftreten, sich in vielen Fällen durch die kombinierten Einflüsse verschiedener Faktoren bedingen. (Martin und Sauerborn 2006)
Syn. Restaurierung; Rückführung in den ursprünglichen, eindeutig historischen Zustand mit verschiedenen, meist technischen Maßnahmen (z.B. bei Fließ- bzw. Stillgewässern und Mooren).
Aktive Wiederherstellung eines ursprünglichen Zustandes, in jedem Fall mit technischen Mitteln.
Biogene Reststoffe werden, im Gegensatz zu Energiepflanzen, nicht eigens für die energetische Nutzung angebaut, sondern sind bei einer anderen, vorherigen Nutzung von Biomasse angefallen. Was auf den ersten Blick als überflüssiger Abfall erscheint, ist aber ein wertvoller Reststoff, der auch energetisch genutzt werden kann. Für Bioenergie werden biogene Reststoffe wie Erntereste, Biomüll, Stroh sowie tierische Exkremente (z.B. Gülle, Mist) genutzt.
Weitere Informationen:
Regionale Bezeichnung der vornehmlich im Schwarzwald früher verbreiteten Feldwald(wechsel)wirtschaft. Es war ein Brandfeldbau im Niederwald, d.h. eine Kombination von Niederwaldbetrieb (Brenn-, Stangenholzgewinnung) mit landwirtschaftlicher Zwischennutzung (Getreide- und Hackfrüchteanbau), bei der die Wälder zur Gewinnung ackerbaulicher Flächen im Abstand von zehn bis dreißig Jahren immer wieder durch Brand gerodet wurden. Die Aschedüngung erlaubte eine ein- bis dreijährige ackerbauliche Nutzung des Bodens. Nach und nach kam es über Stockausschlag zur Wiederbewaldung. Oft wurde zwischenzeitlich die Fläche als Gestrüppweide genutzt.
Die Reutbergwirtschaft begann im 13. Jahrhundert und war geprägt durch hasel- und birkenreiche Weichholzwaldungen. Sie war auf Steillagen in den deutschen Mittelgebirgen, wie z. B. im Mittleren Schwarzwald, weit verbreitet. Für die Holzgewinnung wurde die Bestockung ab einer Stärke von ca. 4 cm genutzt. Es wurde Brenn- und Stangenholz gewonnen.
Häufig wurde die Reutbergwirtschaft auch bei der Gewinnung von Eichenrinde für die Gerberei (Gerberlohe) genutzt. Dann wurden Haseln, Aspen, Sal-Weiden, Birken und Sträucher entfernt, um den Eichen ein gutes Wachstum zu ermöglichen.
Für das Brennen wurde das für die waldwirtschaftliche Nutzung nicht brauchbare Reisig auf der Fläche belassen und in Bahnen, die senkrecht zum Abhang verliefen, verteilt. Im Mittleren Schwarzwald wurden dabei auch die zuvor ausgehackten („abgeschorbten“) und getrockneten Rasensoden verwendet, dabei vor allem auch den Besenginster. Dieses Brennmaterial, die sogenannte Bergreute („Rüttifüre“), wurde dann angezündet und mit langen Brandhaken von oben nach unten über die Fläche gezogen.
Die Brandwirtschaft erwies sich letztlich als gefährlicher Raubbau an der Bodensubstanz und -qualität.
Nach dem Brennen, bei dem Asche zur Düngung anfiel, wurden die Rodungsflächen mit der Hacke gelockert und Getreide wie Winterroggen, Hafer und Buchweizen und/oder Kartoffel eingesät.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts ging die Reutbergwirtschaft stark zurück. Die landwirtschaftliche Nutzung dieser Flächen wurde zunehmend unrentabel und die Holzpreise stiegen. Auch regelten forstpolitische Gesetzgebungen die Nutzung des Walds. Die Reutberge wurden mit Eichen-, Edelkastanien-, Haselniederwäldern aber auch mit ertragreicheren Hölzern, wie Fichte und Tanne, aufgeforstet oder in Weinberge umgewandelt.
(s. a. Haubergwirtschaft)
Weitere Informationen:
Wiederherstellung von erwünschten abiotischen Umweltbedingungen als Voraussetzung für die Ansiedlung von standorttypischen Lebensgemeinschaften (z.B. Revitalisierung von Fließgewässern, Auen und Mooren).
Engl. Akronym für Radio Frequency IDentification, zu deutsch Identifikation mittels Funksignalen in Sender-Empfänger-Systemen. RFID ermöglicht das kontaktlose Speichern und Auslesen von Daten. Das bedeutet das System besteht immer aus mindestens einem RFID Chip (Transponder), der z.B. in einem Kuhhalsband stecken kann und eine Identifikationsnummer trägt und einem Auslesegerät, dass sich z.B. am Melkkarussel befindet. Der große praktische Vorteil der RFID-Technologie liegt dabei vor allem in der winzigen Größe der Chips und darin, dass sie meist keine eigene Stromversorgung benötigen.
Verfahren der Phytosanierung, bei dem die Pflanzen nicht direkt an der Bodensanierung beteiligt sind, sondern durch ihr Wurzelsystem dazu beitragen, dass die mikrobielle Aktivität im Boden erhöht wird. Die Schadstoffe werden dann durch Mikroorganismen abgebaut. Bezogen auf die Grundwassersanierung, bedeutet Rhizofiltration auch allgemein die Absorption und Kondensation an den Pflanzenwurzeln und/oder Aufnahme und Akkumulation in den Wurzeln.
Richtpreise im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik sind heute nur noch in den Marktorganisationen für Zucker sowie Milch und Milcherzeugnisse als Zielpreis von einer gewissen Bedeutung. Sie werden jährlich vom Ministerrat für ein Wirtschaftsjahr einheitlich festgelegt. Richtpreise sind in keinem Falle einem Garantiepreis oder Mindestpreis für die Erzeuger gleichzusetzen.
Auch "Sumpf"; überwiegend baumfreie, teils gebüschreiche, von Sumpfpflanzen dominierte Lebensgemeinschaften auf mineralischen bis torfigen Nassböden, die durch Oberflächen-, Quell- oder hoch anstehendes Grundwasser geprägt sind. Zum Teil sind sie natürlich, vielfach jedoch erst durch Waldrodung und nachfolgende Nutzung als Streuwiese oder Futterwiese entstanden.
Eine Riese (auch Holzriese) ist eine rutschbahnartige Rinne, die traditionell zum Abtransport von geschlagenem Holz aus steilem Gelände eingesetzt wurde. Das Prinzip beruht darauf, dass Baumstämme oder Holzstücke durch ihre eigene Schwerkraft in dieser künstlich angelegten Bahn talwärts gleiten.
Sofern möglich wurde der Holztransport mit den Möglichkeiten der Trift und der Flößerei gekoppelt. Im Idealfall endete die Riese direkt an einem Wasserlauf.
Riesen waren vor der Mechanisierung des Holztransports eine zentrale Technik, um große Holzmengen aus schwer zugänglichen, steilen Wäldern zu transportieren. Sie wurden bereits in der Antike genutzt, etwa beim Transport von Zedernholz aus dem Libanon.
Funktionsweise und Bauweise
Varianten
Bewässerungsform, die häufig auf leicht geneigten Grünlandflächen eingesetzt wird.
Im einfachsten Fall wird bei der wilden Rieselung (Hangrieselung) Wasser auf die Bewässerungsfläche geleitet, über das es entsprechend den Gefälleverhältnissen weitgehend ungeregelt abfließt. Meistens werden jedoch streifenförmige Bewässerungsflächen mit einer Breite von 3–30 m planiert und durch Dämme gegeneinander abgegrenzt (Landstreifenrieselung, Rückenbau). Das nach dem Beckeneinstau, auch Flächeneinstau (Staubewässerung) am weitesten verbreitete Verfahren ist die Furchen- oder Rillenrieselung. Dabei werden Furchen mit einer Breite von 25–30 cm und einer Tiefe von 15–20 cm vom Bewässerungswasser durchflossen, das von einem Verteilerkanal über Auslässe und Heber zugeleitet wird.
(s. a. Bewässerung)
Fläche, auf denen Abwässer nach mechanischer Vorreinigung über landwirtschaftliche Flächen geleitet wird. Rieselfelder können pro Jahr mit etwa 3 m³/m² Abwasser beschickt werden. Der Hauptzweck sind Abwasserreinigung und manchmal Grundwasseranreicherung; die landwirtschaftliche Nutzung steht im Hintergrund. In Deutschland werden Rieselfelder in Berlin und Münster betrieben.
Anthropogene Böden, die durch tiefgründige Bodenumschichtung (Rigolen, von franz. rigole = Rinne) entstanden sind. Dies trifft für die z.T. über 1.000 Jahre alten Weinbergböden zu, die früher alle 30 - 80 Jahre mit der Hand, heute alle 20 - 40 Jahre maschinell rigolt werden, und deren Rigolhorizont (R) 50 - 80, selten bis 120 cm mächtig ist und unterschiedlich große Mengen an Fremdmaterial (Gesteinsschutt, Mergel, Löß, Schlacken, Müll u.ä.) enthält. Auch bei Auen- und Marschböden wurden tiefreichende Rigolarbeiten zur Verbesserung des Oberbodens vorgenommen.
Die Böden der Weinberge sind nach vielen Jahren unter der Pflugsohle aber auch im Bereich der Fahrspuren von Schleppern und Erntemaschinen oft stark verdichtet was zu einem schlechten Gasaustausch führt. Rigosole sind nach gewisser Zeit an Humus verarmt und weisen ein Nährstoffungleichgewicht auf. Zudem kommt eine geringe biologische Aktivität. Vor allem auf alten Rebenstandorten zeigt sich daher eine stärkere Rebmüdigkeit mit einer zum Teil hohen Besatzdichte mit Schädlingen, den rebspezifischen Nematoden. Daher wird mit der Neuanlage eines Weinbergs der Boden durch Rigolen verbessert.
Rigosol
Rigosol aus marinen Cyrenenmergeln des Paläogens (oberes Oligozän). Profil: R-Ap/R/IIR/IIIBtv/IVilCv (Tertiär)
Der obere Abschnitt des Bodens wird gepflügt (R-Ap-Horizont). Standort: Weinanbaugebiet Hochheim am Main (Hessen).
Quelle: Alexander Stahr
In vergangenen Zeiten erfolgte das Rigolen in Abständen von etwa 30 bis 80 Jahren. Doch seit Mitte des 19. Jahrhunderts führte die Reblaus (Viteus vitifoliae) im Weinbau Europas zu folgenschweren Verwüstungen. Die Winzer mussten sich auf gegenüber der Reblaus resistente Rebsorten umstellen, wodurch die Weinberge alle 20 bis 40 Jahre neu angelegt werden. Das Rigolen erfolgte bis in die fünfziger Jahre des 20. Jh. fast ausschließlich durch Handarbeit. Heute wird in der Regel mit speziellen und sehr teuren Rigolpflügen in Tiefen von 40 bis 80 Zentimetern gearbeitet.
Durch diese wiederholten und tiefgründigen Rigolarbeiten wurde die natürliche Horizontabfolge der Weinbergböden zerstört und miteinander vermischt, das Ergebnis bezeichnet man als R-Horizont (R von Rigolen). Wo Weinbergböden nur geringe Mächtigkeit besitzen, wurde und wird beim Rigolen auch unverwittertes Gestein erfasst und dem R-Horizont beigemischt. Zur Verbesserung des Bodens, aber auch um Erosionsschäden auszugleichen, wurde Boden- und Gesteinsmaterial in den Weinbergen aufgebracht. Das geschieht auch heute noch in beachtlichen Mengen. Hinzu kommen größere Mengen an Kohlenschlacken, Trester, Schlamm und Kompost. Weinbergböden werden somit vor der Neuanlage von Grund auf völlig neu aufgebaut.
Weitere Informationen:
Nutztier, das zur Produktion von Milch und/oder Fleisch gehalten wird. Früher wurden Rinder auch als Last- und Zugtiere verwendet. Das europäische Rind stammt vom Auerochsen (Ur) ab. Alle hierzulande gehaltenen Rinderrassen gehören zur Spezies Europäisches Hausrind (Bos taurus)
Rinder sind wiederkäuende Paarhufer. Beide Geschlechter haben Hörner. Rinder werden heute in Deutschland i.d.R. aus Zuchtgründen künstlich besamt. Die Tragzeit dauert 9 Monate und 9 Tage. Neben den reinen Fleischrindern (z.B. Charolais und Angus) werden auch Nachkommen der Milchkuhrassen geschlachtet, die nicht zu Milchkühen großgezogen werden. Das sind zum einen die männlichen Tiere, aber auch die weiblichen Tiere, die nicht zur Milcherzeugung genutzt werden sollen. Diese Rinder werden entweder nach einer dreimonatigen Mastzeit als Kälber oder nach 1 ½ Jahren als Masttiere geschlachtet. Als „Nebenprodukt“ wird die Rinderhaut gegerbt und dann als Leder verwertet. Auch Kühe werden geschlachtet, wenn nach einigen Jahren die Milchproduktion nachlässt.
Der Selbstversorgungsgrad für Rind- und Kalbfleisch lag 2017 in Deutschland bei 97 %, für Milch bei 112 %.
Der Oberbegriff Rind wird für weibliche und für männliche Tiere verwendet, aber je nach Alter, Geschlecht und Nutzungsform gibt es für Rinder verschiedene Bezeichnungen. Einige sind in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen, andere werden meist unter Fachleuten verwendet und tauchen nur hin und wieder mal in den Medien auf, wenn es um das Thema Landwirtschaft geht.
| Kuh | "Kuh" wird ein weibliches Rind genannt, wenn sie das erste Mal ein Kalb bekommen hat. Kühe, die vorwiegend zur Milcherzeugung gehalten werden, nennt man "Milchkühe". Solche, die ausschließlich ihre Kälber aufziehen werden als "Mutterkühe" bezeichnet. Daraus leitet sich auch der Begriff "Mutterkuhhaltung" ab, bei der die Kühe zusammen mit Ihren Kälbern – meist in Freilandhaltung – zur Fleischerzeugung gehalten werden. Zieht eine Kuh neben ihrem eigenen Kalb auch fremde Kälber mit auf, nennt man sie "Ammenkuh". |
| Färse | Als "Färse" bezeichnet man ein geschlechtsreifes weibliches Rind – so lange, bis es das erste Kalb zur Welt bringt. Im Süddeutschen ist der Begriff "Kalbin" geläufiger. In der Regel werden Färsen ab einem Alter von 18 Monaten das erste Mal besamt (seltener von einem Bullen gedeckt) und kalben dann mit etwa 27 Monaten. |
| Kalb und Jungrind | Die noch nicht geschlechtsreifen Jungtiere des Hausrinds bezeichnet man bis zu einem Alter von sieben Monaten als "Kalb". Männliche Kälber nennt man "Bullenkalb", die weiblichen "Kuhkalb". Gehen die Kälber in die Mast, werden sie auch als "Mastkälber" bezeichnet. Zwischen dem achten und zwölften Monat kommen Rinder in die Geschlechtsreife. In dieser Phase nennt man sie "Jungrinder". Bis sie zur Zucht verwendet werden, vergehen aber noch einige Monate. |
| Fresser | Rinder, die zwischen ungefähr 5 Monaten und einem Jahr alt sind, nennt man auch "Fresser". Sie heißen Fresser, weil sie komplett von der Milch entwöhnt sind und ohne Probleme Raufutter fressen können. In dieser Zeit wachsen die Tiere schnell und fressen auch sehr viel. |
| Bulle oder Stier | Das geschlechtsreife männliche Hausrind wird als "Bulle" oder "Stier" bezeichnet. Bullen, die zur Zucht verwendet werden, nennt man "Zuchtbullen", solche die gemästet werden "Mastbullen". "Jungbullen" sind männliche Rinder im Alter von ein bis zwei Jahren. |
| Ochse | Ein "Ochse" ist ein kastriertes männliches Hausrind. Im Gegensatz zum unkastrierten Bullen lässt sich ein Ochse gut abrichten und ist damit zahmer. Das war früher von Bedeutung, als man die männlichen Tiere noch als Zug- und Arbeitstiere verwendete. Aber auch heute noch werden Bullen kastriert, weil sich mit ihnen hochwertigeres, gut marmoriertes Fleisch erzeugen lässt. Ochsen wachsen sehr viel langsamer als ihre unkastrierten Artgenossen. Sie sind aber besser für die Weidemast geeignet. |
Weitere Informationen:
Alternativprodukt zu Torfsubstraten vor allem für den Einsatz im Gartenbau. Man unterscheidet drei Produktgruppen:
Siehe BST
Bezeichnung für verschiedene Systeme zur Produktion von Rindern und deren Erzeugnissen. Die wichtigsten Erzeugnisse sind Milch und Rindfleisch, das wichtigste Nutztier ist das Hausrind.
Rinderhaltung hat eine lange Tradition: bereits vor etwa 10.000 Jahren wurden Auerochsen domestiziert. Seither liefern Rinder neben Milch, Fleisch, Leder oder Fellen auch Gülle oder Jauche und Mist, die in der Landwirtschaft als natürliche Düngemittel oder auch als Brenn- und Baumaterial eine wichtige Rolle spielen. Außerdem erfüllen besonders Ochsen in vielen Teilen der Welt noch heute als Zugtiere für Karren oder zum Pflügen eine wichtige Funktion. Ferner sind Robustrassen wie das Schottische Hochlandrind, Ungarisches Steppenrind, Heckrind, Galloway-Rind oder südeuropäische Primitivrassen wie Sayaguesa ein wichtiger Faktor in der Landschaftspflege und im Naturschutz (Almwirtschaft). Mit Beginn der Mechanisierung der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert verlor das Rind als Zugtier besonders in Industrieländern an Bedeutung.
Der Zuchtfokus auf zwei wesentliche Nutzungsarten begann ab 1700 und dominiert bis heute: Rinder sind entweder auf Fleischproduktion oder auf hohe Milchproduktion spezialisiert. Nur wenige Rassen sind auf Doppelnutzung gezüchtet, zumal die Unterschiede auch genetisch verwurzelt sind.
Zu den Milchrassen gehört die in Deutschland am weitesten verbreitete Rasse, die Deutsche Holstein. Die Tiere können rot- oder schwarzbunt sein. Als reine Milchrasse bekannt sind auch die Jersey-Rinder und das Deutsche Braunvieh.
Fleischrassen liefern ausschließlich Fleisch. Ihre Milch wird lediglich für die Aufzucht der Kälber verwendet, zum Beispiel bei der Mutterkuhhaltung. Beispiele für Fleischrassen sind Charolais, Limousin, Aberdeen Angus, Hereford und Galloway.
Zweinutzungsrassen werden als Milch- und als Fleischlieferanten genutzt. Fleckvieh als Vertreter der Zweinutzungsrassen ist dabei die in Deutschland insgesamt am zweithäufigsten vorkommende Rasse.
Neben Fleisch und Milch liefert das Rind heute auch noch eine Vielzahl von anderen Produkten beziehungsweise Rohstoffen.
Etwa die Hälfte aller Landwirte in Deutschland hält Rinder, um Milch, Fleisch oder beides zu erzeugen. Damit sind Rinder ökonomisch gesehen die wichtigsten Nutztiere der deutschen Landwirtschaft. Während die Zahl der Rinderhalter sinkt, steigen die Herdengrößen: Über zwei Drittel der Rinder leben in Betrieben, die mindestens 100 Tiere halten.
In der Fleischproduktion der Rinder wird im Wesentlichen zwischen Kälbermast, Färsen- und Jungkuhmast, Ochsenmast und Jungbullenmast unterschieden. Die Jungbullenmast ist die bedeutendste Produktionsmethode in Deutschland.
Deutschland ist der größte Milcherzeuger der Europäischen Union und nach Frankreich der zweitgrößte Erzeuger von Rind- und Kalbfleisch.
Moderne Rinderhaltung heißt, Tierschutz, Verbraucherwünsche und Ökonomie in Einklang zu bringen. Das Haltungssystem, das heißt die Art und Weise, wie das Umfeld der Rinder gestaltet ist, die Konstruktion des Stalls und die Fütterung sind von der Art der Erzeugung – Milch, Rind- oder Kalbfleisch – abhängig. Es gibt spezielle Haltungssysteme für Milchkühe, Bullen und Kälber.
In Deutschland leben drei von vier Rindern in Laufställen, in denen sie sich relativ frei bewegen können. Die Ausgestaltung dieser Ställe variiert erheblich. Die Spannbreite reicht von Ställen, deren Boden komplett aus Betonspalten besteht (meist Rindermastbetriebe), bis hin zu großzügig bemessenen Boxenlaufställen, in denen jeder Milchkuh eine mit Einstreu (zum Beispiel Stroh) gepolsterte Ruhezone zur Verfügung steht.
Daneben ist, insbesondere auf kleineren Höfen, noch die Anbindehaltung anzutreffen: Hier stehen die Tiere angebunden in Reihen nebeneinander und können lediglich aufstehen oder sich hinlegen. Etwa jedes fünfte Rind wird in Deutschland so gehalten.
Unabhängig von der Haltungsform im Stall hat etwas mehr als jedes dritte Rind im Sommer regelmäßigen Weidegang, im Durchschnitt etwa ein halbes Jahr lang. Das Weiden von Kühen leistet einen wichtigen Beitrag für die Pflege des Grünlands.
Der Platzbedarf für die Tiere in der Intensivtierhaltung soll zwar möglichst minimiert werden, jedoch sind mit der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung teilweise Grenzwerte festgelegt. Über acht Wochen alte Kälber dürfen so nur in Gruppen bis zu drei Tieren pro Bucht bei einer Mindestbodenfläche von 6 Quadratmeter gehalten werden um sich ohne Behinderung umdrehen zu können.
Bei extensiven Mastverfahren wachsen die Tiere langsamer und erreichen das Schlachtgewicht später als bei der intensiven Mast. Die Unterbringung der Rinder erfolgt überwiegend in eingestreuten Ställen. Vor allem frühreife Rassen wie Angus, aber auch Färsen und Ochsen ( männliche, kastrierte Rinder) werden überwiegend extensiv gemästet. Einerseits nehmen sie nicht so schnell zu wie die intensiv gemästeten Tiere. Andererseits neigen sie zum Verfetten und dürfen deshalb auch nicht so energiereich gefüttert werden.
Färsen werden je nach Rasse und Anzahl der Weideperioden mit etwa 13-22 Monaten geschlachtet. Ochsen werden bis zum Alter von 32 Monaten gemästet. Bei ihnen ist die Weidehaltung einfacher als bei den Jungbullen, da die Tiere nicht so aggressiv sind. Wie bei den Ochsen ist bei den Färsen der Fettgehalt des Fleisches höher, was die Fleischqualität verbessert.
Die Mutterkuhhaltung ist die extensivste Form der Rindfleischerzeugung. Dabei können die Tiere ganzjährig draußen bleiben oder sie werden nur im Winter in den Stall geholt. Das Kalb bleibt von der Geburt bis zum Absetzen (= Trennen) im Alter von etwa 6-10 Monaten bei der Mutter. Dann wird das Kalb entweder mit einem Gewicht von 300 kg als Milchmastrind geschlachtet oder es wird anschließend noch wie oben beschrieben intensiv gemästet. (BZfE)
Bei der pastoralen Extensivhaltung auf Naturweiden (Ranching, Mobile Tierhaltung) werden wenige Tiere auf sehr großen Flächen gehalten.
Das Haupt- oder Grundfutter für die Rinder erzeugt der Landwirt überwiegend selbst auf den Flächen seines Betriebs. Wenn Grundfutter zugekauft werden muss, ist eine rentable Rindermast nur noch schwer möglich, weil die Erzeugungskosten zu hoch werden. Zum Grundfutter zählen Gräser, Kräuter, Pflanzen des Feldfutterbaus wie Mais. Es wird frisch, siliert oder getrocknet angeboten.
Meistens wird das Futter durch Silieren haltbar gemacht. Dafür schüttet man es auf einer ebenen Fläche, dem Fahrsilo, auf und verdichtet es. Wichtig ist ein luftdichter Abschluss mit einer Plane, damit die Milchsäuregärung ablaufen und das Futter haltbar gemacht werden kann. Dies ist vergleichbar mit den Vorgängen bei der Sauerkrautherstellung.
Wasser muss den Tieren immer in ausreichender Menge zur freien Verfügung stehen. Dies wird über automatische Tränkeeinrichtungen gewährleistet.
Das Grundfutter alleine wird den Bedürfnissen des Mastviehs, vor allem in der Intensivmast, nicht gerecht. Deshalb fügt man Kraftfutter bzw. Ergänzungsfutter hinzu. Meistens fehlt es an Eiweiß, Energie und Mineralien. Kraftfutter kann zum Beispiel sein: Soja, Ackerbohnen, Erbsen, Getreide, Biertreber oder Zuckerrübenschnitzel. An Mineralien fügt man je nach Gehalt im Grundfutter Calcium, Phosphor, Kalium, Magnesium, Spurenelemente und Vitamine hinzu.
Seit 2006 dürfen Antibiotika nicht mehr als Leistungsförderer in der Mast eingesetzt werden. Bereits seit 1988 ist die Verwendung von Hormonen als Wachstumsförderer in der Tierzucht in der EU verboten. Nur wenn ein Tier erkrankt ist, darf es nach tierärztlicher Anweisung mit Antibiotika und Hormonen behandelt werden.
Deutschland ist der größte Milcherzeuger der Europäischen Union und nach Frankreich der zweitgrößte Erzeuger von Rind- und Kalbfleisch. Etwa jeden vierten Euro erwirtschaften die deutschen Landwirte mit der Milch und dem Fleisch der Rinder - 2019 summierte sich der Produktionswert auf 14,5 Milliarden Euro. Über drei Viertel davon, mehr als elf Milliarden Euro, entfallen auf die Milch. Diese wird fast vollständig in heimischen Molkereien zu Trinkmilch, Butter, Joghurt, Käse und anderen Milchprodukten weiterverarbeitet. Knapp die Hälfte dieser Milchprodukte wird exportiert, davon 84 Prozent in Länder der EU. Wichtige Drittlandmärkte sind Russland, USA und China.
| Bestand: Jährliche Produktion: Jährlich geschlachtete Tiere: | Betriebe mit Rinderhaltung: davon aus ökologischer Erzeugung: |
Die Rinderhaltung und speziell die Milcherzeugung nehmen einen sehr hohen Stellenwert in der deutschen Landwirtschaft ein. Rund ein Viertel des Produktionswerts der deutschen Landwirtschaft geht auf die Rinderhaltung zurück. Gut jeder zweite rinderhaltende Betrieb hat im Jahr 2020 Milchkühe, die mit einem Bestand von rund 3,9 Mio. Milchkühen einen Anteil von rund 35 Prozent der Rinderbestände insgesamt ausmachen. Der restliche Anteil verteilt sich auf weitere Produktionsrichtungen wie die Jungviehaufzucht, Bullenmast und die Mutterkuhhaltung.
Mit rund drei Mio. Tieren leben die meisten Rinder in Bayern. Das entspricht bei einer Betriebszahl von gut 38 800 Betrieben durchschnittlich 76 Rindern pro Betrieb. Danach folgt Niedersachsen mit etwa 2,4 Mio. Tieren. Beide Bundesländer halten zusammen bereits fast die Hälfte (47 Prozent) aller Rinder in Deutschland. Weitere hohe Bestandszahlen gibt es in Nordrhein-Westfalen (1,3 Mio. Tiere) und Schleswig-Holstein (gut 980 000 Tiere).
Deutschlandweit werden rund 11,3 Mio. Rinder in gut 108 000 Betrieben gehalten. Seit 2010 ist die Anzahl der rinderhaltenden Betriebe um 25 Prozent gesunken. Die Anzahl der gehaltenen Rinder hat sich gegenüber der Landwirtschaftszählung 2010 hingegen nicht so stark verändert (minus zehn Prozent).
Eine stärkere Veränderung ist bei den milchkuhhaltenden Betrieben zu erkennen. Hier ist die Anzahl der Betriebe seit 2010 um fast 40 Prozent gesunken, während die Zahl der Milchkühe um lediglich 5,6 Prozent sank.
Sowohl für die rinderhaltenden Betriebe im Allgemeinen als auch für die Milchviehbetriebe im Speziellen zeigt sich, dass sich die – vergleichsweise konstante – Zahl der Tiere im Laufe der vergangenen zehn Jahre auf immer weniger Betriebe verteilt hat. Mit anderen Worten: Die Betriebe sind gewachsen.
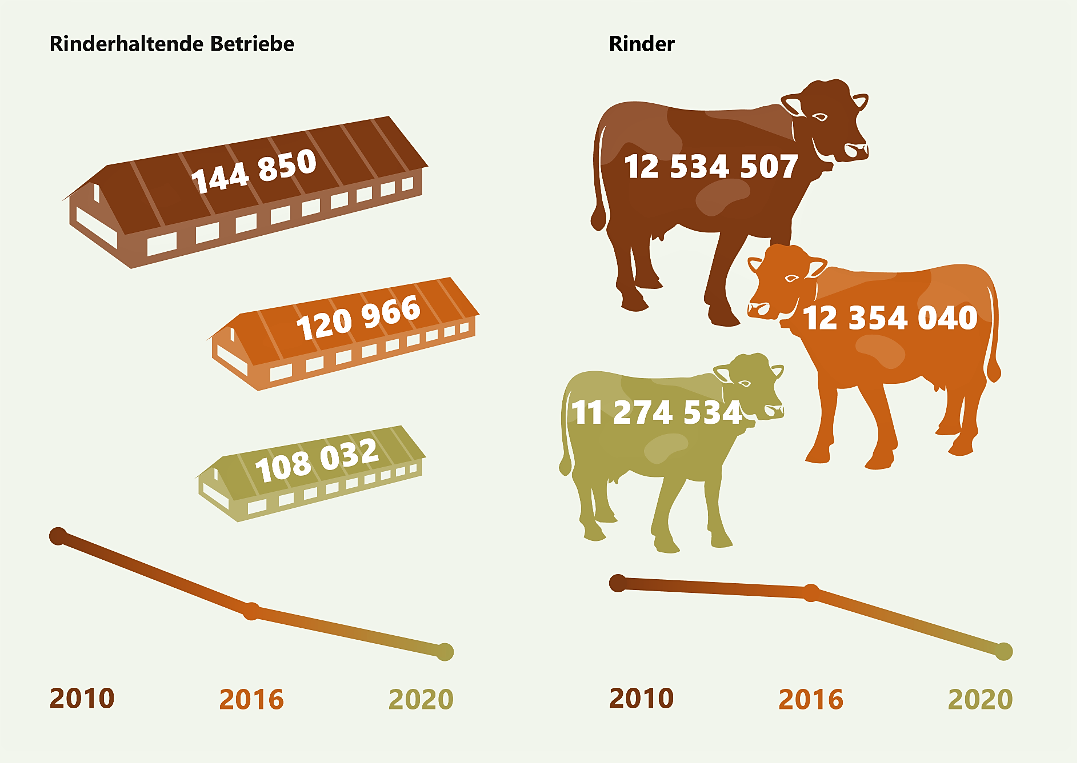
Quelle: Destatis 2021
Neben den absoluten Zahlen lässt sich mit den Ergebnissen der Landwirtschaftszählung der sogenannte Rinderbesatz errechnen. Hierbei wird die Anzahl der Rinder in Abhängigkeit zur landwirtschaftlich genutzten Fläche gesetzt, um die Dichte an Tieren genauer beschreiben und regionale Schwerpunkte identifizieren zu können.
Eine intensive Rinderhaltung ist in der Regel an Standorten mit guten Bedingungen zur Grundfuttererzeugung sowie in Gegenden, die aufgrund weniger ertragreicher Böden, extremer Hanglagen oder klimatischer Nachteile einen hohen Dauergrünlandanteil haben, verstärkt zu finden.
In Deutschland sind die höchsten Rinderbesatzzahlen (140 und mehr Rinder je 100 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche) in Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg zu finden. Von den zehn Kreisen mit dem höchsten Rinderbesatz befinden sich fünf in Niedersachsen (Wesermarsch, Leer, Ammerland, Cuxhaven, Friesland), vier in Bayern (Landkreis Rosenheim, Unterallgäu, Berchtesgadener Land, Mühldorf a. Inn) und einer in Nordrhein-Westfalen (Borken). In den Kreisen Schaumburg (Niedersachsen) und Ilm-Kreis (Thüringen) fallen die Besatzdichten dagegen verhältnismäßig gering aus (knapp unter 30 Rinder je 100 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche).
Weitere Informationen:
Mast von männlichen, weiblichen und kastrierten Rindern. In der Praxis werden meist nur Jungtiere - meist bis zum Alter von 18 bis 24 Monaten - gemästet da vor allem zartes Fleisch mit geringem Fettanteil nachgefragt wird.
Fast die Hälfte des in Deutschland erzeugten Rindfleischs stammt von Jungbullen. Dabei handelt es sich um männliche Tiere im Alter von ein bis zwei Jahren, die explizit zur Fleischerzeugung gehalten werden. Fleisch von Zuchtbullen spielt dagegen so gut wie keine Rolle mehr. Denn aufgrund der heute vorherrschenden künstlichen Besamung in der Milchviehhaltung und der geringen Bedeutung der Mutterkuhhaltung (nur 14 % der Gesamtkuhzahl) ist ihre Zahl nur noch verschwindend gering.
Weitere 32 Prozent des Rindfleischs in Deutschland stammt von (Alt-)Kühen aus Milchvieh- und Mutterkuhherden. Fleisch von Färsen, Jungrindern (8 bis 12 Monate), Kälbern (< 8 Monate) und Ochsen macht hierzulande zusammen rund 22 Prozent aus.
In der Bullenmast unterscheidet man vor allem zwischen drei Mastverfahren: Intensiv-, Wirtschafts- und Weidemast.
Die Intensivmast ist in spezialisierten Bullenmastbetrieben am weitesten verbreitet. Dabei wird das hohe Wachstumspotenzial der Bullen durch eine sehr nährstoffreiche Fütterung mit energiereicher Maissilage als Grundfutter und Kraftfutterergänzung von Anfang an voll ausgeschöpft. Die Wirtschaftsmast strebt dagegen hohe Tageszunahmen erst zu einem späteren Mastabschnitt an. Dann lässt sich der Nährstoffbedarf der Tiere wegen des größeren Futteraufnahmevermögens besser über wirtschaftseigenes, hochverdauliches Grundfutter decken und es muss weniger teures Kraftfutter gefüttert werden.
Die Ausgestaltung des jeweiligen Mastverfahrens richtet sich in erster Linie nach der eingesetzten Rasse. So müssen für fleischbetonte Rinderrassen mit hohem Wachstumspotenzial wie Fleckvieh, Gelbvieh oder Charolais andere Strategien gefahren werden als für weniger wachstumsintensive milchbetonte Rassen wie zum Beispiel Deutsche Holsteins. Auch das Alter der Tiere spielt eine wichtige Rolle für das Mastverfahren.
Die Haltungsbedingungen sind in den intensiven Verfahren der Rindermast weitestgehend standardisiert. Meist werden die Tiere in Gruppenbuchten mit sechs bis acht Tieren auf Vollspaltenboden gehalten. Es gibt aber auch Haltungen mit Tretmist, in denen eine mit Stroh eingestreute Liegefläche mit einer planbefestigten Fressfläche kombiniert wird. Jungtiere werden unabhängig vom Stallsystem in der Mast bis zum Absetzen von der Milch auf Stroh oder auf weichen Liegeflächen gehalten.
Bei der Weidemast werden die Tiere saisonal oder ganzjährig auf der Weide gehalten. Zukauffutter wird nur in den Wintermonaten und in der Endmastphase verwendet. Die Weidemast hat in Deutschland allerdings nur wenig Bedeutung.
Laut der Agrarmarkt Informations-GmbH (AMI) nimmt die Erzeugung von Bio-Rindfleisch seit Jahren stetig zu. 66.600 Tonnen (Schlachtgewicht) Bio-Rindfleisch wurden 2021 erzeugt. Das sind 6,2 Prozent der gesamten Rindfleischproduktion in Deutschland. Ein großer Teil des Fleischs stammt von Altkühen aus der Milchviehhaltung. Aber auch die ökologische Mutterkuhhaltung trägt ihren Teil dazu bei. Knapp 30 Prozent aller in Deutschland gehaltenen Mutterkühe leben inzwischen auf Bio-Betrieben (2020). Das liegt daran, dass diese Form der Haltung den ökologischen Haltungsanforderungen mit viel Auslauf am nächsten kommt. Allerdings wird noch ein Großteil der aus der Bio-Mutterkuhhaltung stammenden Absetzer und Jungbullen in konventionellen Betrieben gemästet.
Anders als in der konventionellen Rindermast spielt im Ökolandbau stärker auch die Ochsen- und Färsenmast eine Rolle. Denn Ochsen und Färsen können im Gegensatz zu Bullen problemloser auf der Weide gehalten werden. Damit kann das für alle Öko-Wiederkäuer geltende Sommerweidegebot besser umgesetzt werden. (BLE)
Weitere Informationen:
Rinderrassen gehen wie die anderen Haustiere auf ehemalige Wildtiere zurück. Als Stammform unserer heutigen Rinderrassen in Europa gilt der Auerochse oder Ur, der bereits im Mittelalter ausgestorben ist. Die Domestikation des Rindes hat schon 6.000 - 8.000 v. Chr. begonnen. Die Entwicklung über primitive, leistungsschwache Landrassen zu den Kultur- oder Zuchtrassen der Gegenwart begann erst im 18. und 19. Jahrhundert. Eine wichtige Zwischenstation auf dem Weg zum heutigen Leistungsstand war die Einführung der Herdbücher in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Heute organisiert und betreut die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter als Dachorganisation die Zuchtarbeit in und zwischen den angeschlossenen Zuchtverbänden.
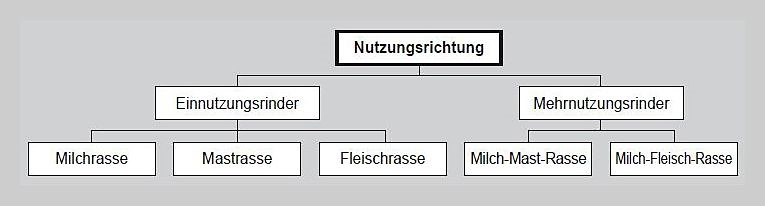
Weitere Informationen:
Auch Echte Hirse (Panicum miliaceum), engl. ugs. Proso millet u. w.; eine Pflanzenart aus der Gattung Rispenhirsen (Panicum). Diese Hirsenart ist eine alte Getreidepflanze. In Europa von Kartoffel und Mais verdrängt wird sie heute noch in weiten Teilen Asiens angebaut.
Die Rispenhirse ist eine einjährige krautige Pflanze und erreicht Wuchshöhen von 30 bis 100, selten bis 150 Zentimetern. Der rispige Blütenstand ist 10 bis 30 Zentimeter lang, aufrecht bis überhängend, locker bis dicht. Die Blütezeit reicht von Juni bis September. Es erfolgt Selbstbestäubung. Die Rispenhirse gehört zu den C4-Pflanzen.
Das Tausendkorngewicht liegt zwischen 4 und 8 Gramm. Der Eiweißgehalt beträgt bis zu 10 (selten sogar bis 18) Prozent, der Fettgehalt rund 4 Prozent. Manche Sorten sind sogar Kleber-haltig und liefern somit backfähiges Mehl.
Die Rispenhirse wird vor allem in Zentralasien, nördlichen China, Japan und Indien angebaut. Die Vegetationszeit beträgt je nach Standort und Sorte 60 bis 90 Tage, der Wasseranspruch ist relativ gering. Die nördliche Anbaugrenze ist die 20 °C-Juli-Isotherme. Im Himalaja wird die Rispenhirse bis in Höhenlagen von 3000 Metern angebaut. Die Körner reifen in den Rispen nicht gleichzeitig, durch hohe Ausfallgefahr erfolgt die Ernte vor der Vollreife. Die Erträge liegen meist bei rund 1 Tonne pro Hektar und können unter günstigen Bedingungen bis 5 Tonnen betragen.
Die Früchte werden als Korn, Brei und Brot verzehrt oder auch zu Hirsebier verarbeitet. In Nordchina wird es auch für die Herstellung von Hirsewein (ähnlich dem Reiswein Huang Jiu 黄酒) verwendet. Das Stroh ist als Futter für Wiederkäuer gut geeignet.
Die Rispenhirse, im 19. Jahrhundert noch „der Hirse“, ist eine der am frühesten domestizierten Getreidearten, ihr Ursprung liegt in Zentralasien. Die ältesten Funde stammen aus dem Alt-Neolithikum.
In Europa ist sie ab der ausgehenden Mittleren Bronzezeit belegt und wird vor allem in Mitteleuropa und Südosteuropa während der Späten Bronzezeit zu einem der Hauptgetreide. In Deutschland kommt sie in vorrömischer Zeit in rund 30 % aller Fundstellen vor. In den ersten drei nachchristlichen Jahrhunderten wurde die Rispenhirse teilweise durch die Gerste verdrängt. Die Römer nannten die Rispenhirse milium und verwendeten sie zu Brot und Brei.
Im Mittelalter war sie in Mitteleuropa ein wichtiges Nahrungsmittel und galt als das „Brot des armen Mannes“. Der Schwerpunkt verlagerte sich jedoch Richtung Osteuropa. Sie wurde nur als Brei gegessen, da es keine kleberhaltigen Sorten gab. Sie wurde in Mitteleuropa später von der Kartoffel weitgehend verdrängt, in Südeuropa vom Mais. Der Anbau wurde in sandigen Gebieten bis Anfang des 20. Jahrhunderts betrieben, so etwa in Pommern, Posen, Thüringen, Brandenburg, in den unteren Donauländern und im südlichen Russland. In Österreich wird sie zur Vogelfutterproduktion angebaut, teilweise auch wieder als Getreide.
In Mitteleuropa wächst sie wild auf Schuttplätzen, Bahnanlagen und in Häfen. In Gärten verwildert sie meist aus Vogelfutter. Sie kommt vor allem auf nährstoffreichen, leichten und sandigen Lehmböden der collinen, seltener auch der montanen Höhenstufe vor.
(s. a. Hirse)
Weitere Informationen:
Ein Rittergut (lat. praedium nobilium sive equestrium) war ein Besitz, mit dem durch Gesetz oder Gewohnheitsrecht seit dem Mittelalter bestimmte Vorrechte des Eigentümers, insbesondere die Rechte der Grundherrschaft über erbuntertänige und zinspflichtige Bauern (bis zur Bauernbefreiung) sowie die Landtagsfähigkeit verbunden waren. Hinzu kamen oft die Kanzleifähigkeit (als erste Instanz in Rechtsstreitigkeiten) sowie Steuerbefreiungen.
Ein Roboter ist eine Maschine, die in der Lage ist, ohne direkten menschlichen Eingriff autonom zu arbeiten. Sie kann stationär (z. B. ein Melkroboter) oder mobil (z. B. selbstfahrend) sein. Der Begriff wird vor allem in den Medien und in der breiten Öffentlichkeit verwendet. Roboter werden oft vermenschlicht. In technischeren Diskussionen werden eher Begriffe wie autonome Maschine oder autonome Ausrüstung verwendet.
Rodentizide sind Pestizide, die gegen Nagetiere (Rodentia) eingesetzt werden. In der Praxis dienen sie bei uns v.a. der Bekämpfung von (Wühl-)Mäusen sowie von Ratten. Neben eigentlich giftigen Stoffen werden zur Nagetierbekämpfung auch Repellents eingesetzt sowie Chemosterilantien zur Reduzierung der Fruchtbarkeit.
Chemisch unterscheidet man bei Rodentiziden
Getreideart (Secale cereale) aus der Familie der Süßgräser (Poaceae). Der Roggen besitzt 65 bis 200 Zentimeter lange Halme und 5 bis 20 Zentimeter lange, vierkantige, zur Blütezeit leicht überhängende Ähren aus einzelnen, meist zweiblütigen Ährchen mit schmalen Hüllspelzen und langbegrannten Deckspelzen. Die Tausendkornmasse (Masse von 1000 Körnern) beträgt bei Roggen 28 bis 50 Gramm.
Die Heimat des Roggens liegt vermutlich im Kaukasusgebiet. Von dort ist es als Unkraut des Weizens über Kleinasien nach Europa gelangt. Seit 4000 v. Chr. wird er systematisch angebaut. Ab 500 n. Chr. fand er nach Mitteleuropa.
Da Roggen sehr winterhart ist (bis - 25 °C) und aus sandigen Böden mit geringer Fruchtbarkeit wachsen kann, wird er in Regionen angebaut, die für andere Getreidearten nicht geeignet sind (Keimungsminimum bei 1–2 °C, Blüte schon bei 12 °C). Allerdings verträgt Roggen keine Staunässe. Solche Bedingungen findet man vor allem in nördlichen Gebiete mit gemäßigtem Klima zu, aber auch in semiariden Gebieten in der Nähe von Wüsten oder in größeren Höhen.
Heute ist er in Deutschland vor allem in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen zu finden. In diesen Bundesländern gibt es viele sandige Böden mit schlechter Wasserversorgung. Hier kann der Roggen seine Stärke ausspielen: Dank seines tiefenreichenden und verzweigten Wurzelnetzes bringt Roggen selbst in trockenen Jahren im Vergleich zu anderen Kulturen sichere Erträge. Roggen hat aufgrund des gut ausgebildeten Wurzelsystems das beste Nährstoffaneignungsvermögen aller Getreidearten.
Roggen wird nur teilweise als Brotgetreide angebaut. Die Körner sind kleberarm, aber pentosenreich. Das Mehl ist dunkler als das des Weizens. Da es Feuchtigkeit relativ lange hält, wird Roggenmehl mit Sauerteig zur Vorratshaltung gebacken. Roggen dient außerdem der Herstellung von Branntwein (Wodka, Korn, in Kanada und Südkorea auch Rye-Whisky) und Bier, sowie als Kaffeeersatz.
Als Futtermittel werden das Korn oder die grün geerntete Roggenpflanze verwendet. Grünroggen ist das erste Grünfutter in Rinderbetrieben im Frühling. Allerdings enthält Roggen einen hohen Anteil an schwer verdaulichen Nicht-Stärke-Polysacchariden.
Roggenkorn dient auch als nachwachsender Rohstoff zur Herstellung von Bioethanol, Biogas, Werk- und Dämmstoffen und Stoffen für die chemische Industrie.
In Deutschland stieg Roggen im 12. und 13. Jahrhundert zum Hauptbrotgetreide auf. In der Dreifelderwirtschaft war er ein Fruchtfolgeglied neben Gerste oder Weizen und Brache. Bis zum Zweiten Weltkrieg übertraf seine Anbaufläche noch die des Weizens. Mittlerweile bauen Deutschlands Landwirte aber sechsmal so viel Weizen wie Roggen an. Im Mittel der letzten Jahre schwankten die Erntemengen zwischen drei und vier Millionen Tonnen. Davon werden nur rund 0,75 Millionen Tonnen zu Mehl vermahlen. Etwa die Hälfte der Ernte geht hingegen ins Tierfutter, die übrige Menge überwiegend in die Bioethanol-Produktion. In den Raffinerien werden den Treibstoff-Sorten „Super“ fünf Prozent und „Super E10-Benzin“ zehn Prozent beigemischt.
Roggen ist überwiegend als Wintergetreide im Anbau. Im Herbst ausgesät, benötigt er den Kältereiz im Winter, um im Frühjahr schossen und Ähren mit Körnern bilden zu können. Typisch für Roggen ist der hohe Anteil von Hybridsorten. Die Züchterfirmen kreuzen zu diesem Zweck ganz gezielt Inzuchtlinien miteinander. Die daraus hervorgehenden Pflanzen sind leistungs- und widerstandsfähiger als ihre Eltern. Der Effekt hält aber nur eine Generation an.
In Deutschland wuchs 2016 auf rund 0,58 Millionen Hektar Roggen (Weizen: 3,22 Mio. Hektar). Die Durchschnittserträge lagen von 2014 bis 2016 bei 57,8 Dezitonnen pro Hektar (Weizen: 81,3 Dezitonnen). Aus einem Hektar Grünroggen (11,2 Tonnen Trockenmasse) werden ungefähr 2877 Kubikmeter Methan (Silomais: 17,8 Tonnen Trockenmasse, 5038 Kubikmeter. Etwa 3,4 Prozent der deutschen Getreideernte wurde 2015 zu Bioethanol verarbeitet.
Im Weltgetreidehandel spielt Roggen kaum eine Rolle und erfolgt fast nur zwischen Ländern, die eine Roggentradition haben. Hauptproduzenten waren 2017 Deutschland, Polen, Russland und VR China.
Betriebseinkommen minus Fremdlöhne = Einkommen der bäuerlichen Familie aus Boden, Arbeit, Kapital und Unternehmerleistung.
Landwirtschaftliche Betriebseinnahmen plus Wert der Naturalentnahmen für Privat, Altenteil, Naturalpacht und Naturallöhne plus Wert der Bestandsveränderungen an Vieh und selbsterzeugten Vorräten.
Humusform saurer, nährstoffarmer und biotisch wenig aktiver Standorte unter Nadelwald- oder Zwergstrauchvegetation (u.a. Heidekraut). Die schwer abbaubaren Vegetationsrückstände bilden weitgehend unzersetzt einen Auflagehorizont über dem Mineralboden.
Unter stark sauren Bedingungen fehlen die für den Abbau der organischen Substanz verantwortlichen Bodenlebewesen weitgehend. Die säureresistenten Pilze genügen für einen intensiven Abbau nicht. Deshalb bildet sich, im Gegensatz zum Moder, zusätzlich ein Humusstoffhorizont (H-Horizont). Die einzelnen organischen Auflagehorizonte (L+F+H-Horizonte) sind deutlich ausgeprägt. Die organische Auflage kann sehr mächtig sein, und die Übergänge zwischen den einzelnen Horizonten sind meist deutlich erkennbar. Durch die fehlende Durchmischung (Bioturbation) sind alle Horizonte gut voneinander zu trennen. Die Durchmischung des organischen Materials mit der mineralischen Feinerde findet meist nur noch durch Regenwasser statt. Der Oberboden (A-Horizont) ist daher in der Regel sehr geringmächtig (dünn) und nur schwach ausgebildet: C/N-Verhältnis 20 bis 33. Das Nährstoffangebot ist schlecht.
Dieser Bodentyp (frühere Bezeichnung: Salzmarsch) aus Gezeitensediment, das oft eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Sturmflutschichtung aufweist, findet sich im Übergangsbereich zwischen Watt (Bodentyp Watt) und der Marsch. Diese Landschaftsbereiche sind infolge von Sedimentationen und Massenverlagerungen entlang der Küste gegenüber dem Watt leicht erhöht und werden daher nur noch periodisch oder episodisch überflutet. Die Rohmarsch zeigt den Beginn von Bodenbildung.
Wird eine Wattfläche nicht mehr täglich durch die Gezeiten überflutet, so verläuft die Bodenentwicklung vom semisubhydrischen Boden (Watt) in Richtung semiterrestrischer Boden.
Die Normrohmarsch besitzt ein tm(z)eGo-Ah/(tmzeGo/)tmzeGr-Profil. Dabei steht tm für marin, z für salzhaltig und e für mergelig (ton- und kalkhaltig). G ist der Grundwasserbeeinflusste Mineralbodenhorizont (o = oxidiert, r = reduziert). Die in Klammern gesetzten Zeichen (Symbole) und Horizonte können fehlen. Weitere Subtypen sind die Brackrohmarsch, Flussrohmarsch.
Rohmarschen besitzen im unmittelbaren Anschluss an das Watt einen relativ hohen Salzgehalt, der in den Sommermonaten nach starker Evaporation über 10% betragen kann. Beginnende Setzung (Sackung) des Bodens kann sein anfängliches Porenvolumen von mitunter 90% auf 40% verringern (Reifung der Marsch). Im Boden enthaltende Schwefelverbindungen (Eisensulfide) werden durch den Luftsauerstoff mit Beteiligung von Mikrooranismen oxidiert. Es entstehen Eisenoxide und Schwefelsäure, die durch im Boden enthaltene Carbonate (z. B. kalkhaltige Schalenfragmente von Meeresbewohnern) neutralisiert wird. Zunehmende Salzauswaschung weist in Richtung des Bodentyps Kalkmarsch.
Es kommt zur Besiedelung durch Pflanzen [z. B. aus der Gattung der Queller, (Salicornia)] und zur Bildung von Salzwiesen mit einer an die hohen Salzgehalte des Bodens angepassten Pflanzengesellschaft (Halophytenvegetation, von griech. hals = Salz und phytón = Pflanze). (ahabc.de, mod.)
In Deutschland finden sich Rohmarschen entlang der Nordseeküste, wobei der Übergangsbereich zwischen Watt und Marsch größtenteils vor den Deichen liegt (Deichvorland).
Früher wurden diese Flächen systematisch eingedeicht, um Landgewinnung zu betreiben. Dies wird aber nicht mehr praktiziert, da den Deichen etwa seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur noch eine Küstenschutzfunktion zukommt.
Heute kommen dem Bereich der Rohmarsch folgende Funktionen zu:
Rohrzucker ist die Bezeichnung für Haushaltszucker (Saccharose, von lat. saccharum), der aus Zuckerrohr gewonnen wird und auf dem Weltmarkt einen Anteil von 80 Prozent hat.
Das geerntete Zuckerrohr wird in der Fabrik oder bereits bei der Ernte geschnitten. In den meisten Fabriken wird das Rohr in Zuckerrohrmühlen verarbeitet. In den Mühlen wird der Saft aus dem Zuckerrohr herausgepresst („Pressextraktion“), als Restmaterial entsteht die faserige Bagasse, die ebenfalls Verwendung findet.
In einigen Fabriken sind jedoch schon Diffuseure im Einsatz, die den Zucker mittels des Diffusionsprozesses extrahieren. Der gewonnene Saft wird in Absetzer geleitet. Dort werden durch Schwerkraft Schwebestoffe aus dem Saft entfernt. Diese einfache Art der Saftreinigung führt dazu, dass Rohrzucker oft braun ist. Die Reinigung und Kristallisation erfolgt ähnlich wie beim Rübenzucker.
In Mitteleuropa wird die Herstellung von Zucker aus Zuckerrübe politisch gefördert, der chemisch mit reinem Rohrzucker identisch ist. Die Saccharose, aus der Zucker aufgebaut ist, ist ein Disaccharid, also aus zwei Monosaccharidmolekülen (Glucose und Fructose) aufgebaut. Die Summenformel lautet C12H22O11.
1957 in Rom auf dem Kapitol unterzeichnet, markieren die Verträge über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atom-Gemeinschaft (EURATOM), zusammen mit der bereits seit 1951 bestehenden sogenannten Montanunion (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) den Beginn der heutigen EU. Mit den Römischen Verträgen wurde der Grundstein für eine gemeinsame, europaweite Agrarpolitik gelegt. In Artikel 39 wurden die gleichberechtigten fünf Ziele der Agrarpolitik formuliert:
"Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist es,
In die Fruchtfolge integrierte, meist nur ein- oder zweijährige Unterbrechung des Anbaus von Kulturpflanzen auf dem Acker.
Der Rotklee (Trifolium pratense), auch Wiesenklee genannt, gehört wie die Erbse und die Bohne zur botanischen Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae oder Leguminosae). Der Rotklee ist formenreich und zwischen allen Typen gibt es Übergänge.
Der kultivierte Rotklee stammt von dem in Europa heimischen Wiesenrotklee ab. Bereits im 16. Jahrhundert wurde der Kulturrotklee in Spanien, Italien und Flandern angebaut. In Deutschland begann das Zeitalter des Kleebaues um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Begünstigt wurde es durch den bald einsetzenden Übergang zur Verbesserten Dreifelderwirtschaft, in der ein Teil des bisherigen Brachlandes dem Klee eingeräumt wurde.
Untrennbar verbunden mit der Einführung des Rotkleeanbaues ist der Name Johann Christian Schubart, eines sächsischen Gutsbesitzers, der für seine Verdienste von Kaiser Joseph II. 1784 als "Edler von Kleefeld" in den Adelstand erhoben wurde.
Man findet den Rotklee in Fettwiesen, auf Feldern und in lichten Wäldern. Heute wird der Rotklee überall in der gemäßigten bis subarktischen Zone, aber auch in den Gebirgen der Tropen angebaut.
Rotklee gedeiht am besten im gemäßigten, luftfeuchten Klima auf schwerem, tiefgründigen und nährstoffreichem Ton- und Lehmboden. Der pH-Wert sollte 5,5 nicht unterschreiten. Saurer Sand-, trockener Kalkverwitterungs- und Schotterboden sind für den Rotklee ebensowenig geeignet wie Moorboden. Rotklee folgt im allgemeinen auf Getreide und ist selbst eine ausgezeichnete Vorfrucht für Hackfrüchte, Winterweizen, Hafer und Mais.
Der Wiesenklee ist eine eiweißreiche Futterpflanze und wird in Deutschland seit dem 11. Jahrhundert angebaut, Kleekulturen waren aber erst nach 1750 verbreitet. Durch die Symbiose mit stickstofffixierenden Bakterien (Knöllchenbakterien) ist er als Bodenverbesserer und als Vorfrucht für andere Kulturpflanzen sehr gut geeignet; für die Imkerei wurden Sorten mit kürzerer Kronröhre herausgezüchtet. Gemischt mit anderen Kleesorten und Gräsern wird er als Kleegras zur Gründüngung und als Alternative zu Mais in Biogasanlagen verwendet.
Tierische Exkremente mit Stroh vermischt, die während ihrer Lagerung außerhalb des Stalles einen mehrere Monate dauernden Rotteprozess (mikrobielle Umwandlung) mit einem Substanzverlust bzw. Kohlenstoffverlust und der Bildung von Humusstoffen und anderen wertvollen Abbauprodukten erfahren.
(s. a. Gülle, Tiefstallhaltung)
Auch Ru; Bezeichnung für Wasserkanäle im Aostatal, wo eines der dichtesten traditionellen Bewässerungssysteme im Alpenraum besteht. Die Rû wurden einst in die Erde gegraben oder in den Felsen gehauen. Sie sind seit dem 13. Jh in Belehnungsakten verbürgt. Auch im Piemont wird der Begriff verwendet. Das Valle d'Aosta ist nicht nur ein Nachbartal des Wallis, es hat auch sehr ähnliche Bewässerungssysteme hervorgebracht. Die Systeme des Valle d'Aosta sind im Gegensatz zu denjenigen des Wallis durch z.T. sehr viel Mauerwerk gekennzeichnet.
Die Sohlen und Seitenwände der Haupt- und Zuleitungskanäle wurden zumeist mit Steinen und Steinplatten stabilisiert und gegen Wasserverluste abgedichtet, seltener verwendete man Bretter, Holzkästen oder Holzkänel. Der Kanalverlauf wurde je nach Terrain und Gefälle möglichst optimal dem Gelände angepasst und mit steinernen Trockenmauern, Pfeilern und Bodenbrücken abgestützt. Aquädukte überspannten die Wildbäche und Geländesenken, Röhren und Tunnel unterführten Felssporne, Wegenetze und erosionsgefährdete Abschnitte. In den Talböden waren die Rû meist als Erdkanäle angelegt.
Das innermontane Aosta-Tal wird im Norden von den Walliser Alpen und im Süden vom Gebirgsstock des Gran Paradiso abgeschirmt. Das führt im Talgrund der Dora Baltea zu extremer Trockenheit von nur rund 110 mm Niederschlag in den Monaten Juni bis August. Trockene Winde und eine hohe Einstrahlung verstärken die Austrocknung, so dass Bewässerung seit jeher unverzichtbar war. Bewässert wurden vor allem die Futterwiesen, aber auch Äcker und Rebflächen. Die Wasserzuleitungen nutzte man zusätzlich zur Trinkwasserversorgung und zum Betrieb von Mühlen, Sägereien und anderen Gewerben.
Heute ist ein großer Teil der alten Anlagen entweder unter der Siedlungsausdehnung verschwunden oder seit dem späten 19. Jh. durch verrohrte Leitungen und Stollen ersetzt worden. Trotz intensiver Auflassungstendenzen oder Umstellung auf verrohrte Zuleitungen und Sprinklerbewässerung sind einige Teilabschnitte der alten Rû offengehalten (z.B. der "Ru Cortot") und zu attraktiven Leitlinien eines qualitativen Wandertourismus geworden. (Leibundgut/Vonderstrass 2016)
Pflanzenart aus der Familie der Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae). Zu dieser Art gehören die wirtschaftlich bedeutenden Kulturformen Zuckerrübe, Rote Bete, Mangold und Futterrübe, die in der Unterart Beta vulgaris subsp. vulgaris zusammengefasst werden. Sie stammen von der Wilden Rübe (Beta vulgaris subsp. maritima) ab, welche an den Küsten Westeuropas und des Mittelmeeres bis nach Westasien vorkommt.
Rübenzucker ist Zucker, der aus Zuckerrüben (Beta vulgaris) gewonnen wird. Diese Pflanzen sind die bedeutendste Zuckerquelle in gemäßigten Breiten und enthalten einen Zuckergehalt von etwa 18 bis 20 %.
Die Herstellung von Rübenzucker erfolgt durch das Zerkleinern der Rüben, das Entsaften und anschließendes Raffinieren, um die gewünschten Zuckerkristalle zu gewinnen. Chemisch betrachtet ist Rübenzucker identisch mit Haushaltszucker, da beide aus Saccharose bestehen.
Der Hauptunterschied zwischen Rübenzucker und Rohrzucker liegt in der Herkunft: Rübenzucker stammt aus Zuckerrüben, während Rohrzucker aus Zuckerrohr gewonnen wird.
Beide Zuckerarten haben jedoch ähnliche chemische Eigenschaften und können in der Küche austauschbar verwendet werden. Der Begriff "Rübenzucker" wird oft verwendet, um die Herkunft des Zuckers zu kennzeichnen, insbesondere bei Bio-Produkten.
Rübenzucker gilt als nachhaltiger im Vergleich zu Rohrzucker, da er häufig lokal in Mitteleuropa angebaut wird und somit kürzere Transportwege hat. Dies reduziert den ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu Rohrzucker, der aus tropischen Regionen importiert werden muss. Zudem wird bei der Produktion von Rübenzucker darauf geachtet, dass die Nebenprodukte sinnvoll verwertet werden.
Der Rübsen, auch Rübsamen oder die Rübsaat (Brassica rapa) ist eine Art aus der Familie der Kreuzblütengewächse. Der Rübsen wird seit der Jungsteinzeit kultiviert. Es gibt zahlreiche Sorten bzw. Unterarten, die als Öl-, Gemüse- bzw. Futterpflanzen angebaut werden.
Der Rübsen ist in seinem morphologischen Aufbau und botanischen Eigenschaften dem Raps ähnlich. Dies gilt auch hinsichtlich der Inhaltsstoffe der Samen, allerdings sind der Ölgehalt und der Ertrag bei Rübsen niedriger.
Der Rübsen ist eine ein- oder zweijährige Pflanze, die Wuchshöhen von 20 bis 100 cm erreichen. Die Grundblätter sind grasgrün und borstig rau.
Die Blütenknospen werden von den geöffneten Blüten überragt, Der Blütenstiel ist immer länger als die Blüte. Die Kronblätter sind goldgelb und 6 bis 10 mm lang. Die Bestäubung erfolgt durch Bienen, die Blütezeit ist April bis September. Die Frucht ist eine Schote, die Samen sind netzadrig.
Der Rübsen ist im Mittelmeergebiet beheimatet. Als Kulturpflanze ist er weit verbreitet und öfter verwildert.
Weltweit liegen die Hauptanbaugebiete von Rübsen zur Korngewinnung in Kanada und Skandinavien. In Kanada wird infolge der sehr kurzen Vegetationszeit vorwiegend Sommerrübsen angebaut. In Schweden wachsen Winterrübsen im mittleren und nördlicheren Teil, in Norwegen und Finnland treten Sommerrübsen anstelle des Winterrübsens und des Sommerrapses.
Im übrigen Europa wird Rübsen fast nur als Grünfutter und zur Gründüngung angebaut. Hier hat der Rübsen aufgrund seiner frühen Schnittreife und hohen Grünmasseerträge als Zwischenfrucht eine Bedeutung.
Rübsen bieten u. a. dem Rehwild im Winter noch eine saftige Grünäsung und werden daher gerne auf Wildäckern ausgesät.
Aus den Samen der Rübsen gewinnt man das so genannte Rüböl.
Vor allem die Aufhebung von Bodenversiegelungen unterschiedlichster Art, aber auch die Renaturierung von begradigten oder betonierten Fließgewässern. Ziel von Rückbaumaßnahmen ist eine Verminderung des Landschaftsverbrauchs und eine Erhöhung der Vielfalt von Ökosystemen in der Kulturlandschaft.
Oft auch künstlicher Rückenbau; im Rahmen des traditionellen Kunstwiesenbaus erfolgte Umgestaltung der Wiesenoberflächen, wodurch die Wiesenparzellen leicht dachartige Strukturen (Rücken) erhielten, auf deren „First“ der Zuleiter und an deren „Trauf“ der Ableiter war.
Über Zuleitungsgräben konnte das Wasser auf die „Rücken“ geleitet werden, anschließend floss es in den dazwischen liegenden Entwässerungsrinnen wieder ab. Das künstliche Gefälle der Rücken sorgte dafür, dass das Bewässerungswasser immer in Bewegung blieb und für eine ständige „Berieselung“ der Wiesenflächen sorgte – die Rieselwiese war geboren.
Beispiele finden sich u.a. im Siegerland und in den Vogesen.
Rückverfolgbarkeit ist die Möglichkeit, ein Lebensmittel oder Futtermittel, ein der Lebensmittelgewinnung dienendes Tier oder einen Stoff, der dazu bestimmt ist oder von dem erwartet werden kann, dass er in einem Lebensmittel oder Futtermittel verarbeitet wird, durch alle Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen zurück zu verfolgen. Dies wird dadurch gewährleistet, dass auf jeder Stufe der Lebensmittelkette zumindest der unmittelbare Vorlieferant und der unmittelbare Abnehmer bekannt und erfasst sind.
Die Rückverfolgbarkeit ist seit dem 1. Januar 2005 eine rechtliche Verpflichtung für alle Unternehmen der Lebensmittelkette. Dies ist in der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 (Basis-Verordnung) für Lebensmittel verankert. Lebensmittelunternehmen sind demnach auch verpflichtet, Behörden auf Nachfrage über ihre Lieferanten und gewerblichen Abnehmer zu informieren. Außerdem wird den Unternehmen empfohlen, weitere Angaben wie Umfang oder Menge, ggf. Chargennummer und die Beschreibung des Produkts für die Behörden bereitzuhalten. Die Verpflichtung zur Rückverfolgbarkeit gilt jedoch nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für alle Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen (z. B. Verpackungen, Geschirr).
Die Rückverfolgbarkeit ist ein wichtiges Sicherheitsinstrument angesichts der komplexen, globalen Güterströme, um bei besonderen Vorkommnissen durch genaue Ursachenverfolgung Schadensbegrenzung betreiben und Verbraucher gesichert informieren zu können. Jedes einzelne Unternehmen muss vor dem Hintergrund der spezifischen Branchen- und Betriebsstruktur sowie der produkt- und prozessbedingten Grenzen entscheiden, wie es sein Rückverfolgbarkeitssystem konkret gestaltet.
Um Lebensmittel auf dem Markt identifizieren zu können ist die Angabe der Loskennzeichnung auf der Verpackung – bis auf wenige Ausnahmen – rechtlich verpflichtend. Die Los-Angabe besteht aus Ziffern oder Buchstaben, oft auch einer Kombination aus beidem. Zur Kenntlichmachung steht am Anfang in der Regel ein „L“. Eine Los-Angabe steht für die Charge von Verkaufseinheiten der Lebensmittel, die unter gleichen Bedingungen hergestellt wurde. Die Loskennzeichnung hat sich seit Jahren bewährt. Für den Fall, dass ein Warenrückruf oder eine öffentliche Warnung notwendig wird, können die Lebensmittelunternehmer gezielt reagieren. Auch der Verbraucher kann so anhand der Los-Angabe feststellen, ob die Warnung auch für seine Vorräte gilt.
Lebensmittel, die lose verkauft werden, d. h. nicht in Fertigpackungen verpackt sind, und Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Tag und Monat genau angeben, müssen keine Losnummer tragen. (BLL)
Im engeren Sinne Bezeichnung für nährstoffreiche, vor allem stickstoffreiche Standorte, die unter dauerndem menschlichen Einfluss stehen und denen gewöhnlich eine echte Horizontbildung des Bodens fehlt. Ihr Untergrund zeichnet sich durch große Schwankungen der Temperatur und Feuchtigkeit aus. Beispiele sind Abfallhaufen, Müllplätze, unbebaute Grundstücke. Typische Ruderalpflanzen sind die Große Brennessel und der Sauerampfer. Im weiteren Sinne werden auch Wegränder und Feldraine als Ruderalstellen bezeichnet.
Spezialschaffarm in Australien zum Zwecke der Wollgewinnung.
Rundplatzdorf mit zentralem Anger in Schleswig-Holstein. Alter und Genese sind unsicher, möglicherweise liegt eine Variante des Fortadorfes vor.
Rundballen sind zylinderförmige, gepresste Ballen aus Erntegut wie Heu, Stroh oder Grassilage. Sie entstehen, indem das Schnittgut mit einer speziellen Maschine, der Rundballenpresse, aufgerollt und stark verdichtet wird. Die Ballen haben typischerweise einen Durchmesser von 90 bis 180 cm, sind etwa 120 cm breit und können – je nach Material und Feuchtigkeit – zwischen 200 kg (Stroh) und 1000 kg (Grassilage) wiegen.
Herstellung und Funktion
Das Erntegut (z. B. frisch gemähtes Gras) wird nach kurzem Antrocknen auf dem Feld mit einer Rundballenpresse aufgenommen und zu einem kompakten Ballen geformt. Hierzu muss Erntegut in Schwaden vorliegen.
Für Silage oder Heulage werden die Ballen anschließend mit mehreren Schichten dehnbarer Stretchfolie luftdicht eingewickelt. Dadurch entsteht ein sauerstofffreies Milieu, in dem Milchsäuregärung einsetzt und das Futter über Monate haltbar macht – ähnlich wie bei der Sauerkrautherstellung.
Die runde Form erleichtert den Transport und das Handling, da die Ballen über kurze Strecken auch gerollt werden können.
Rundplatzdorf mit Hofstätten, die sektorenförmig um einen in Gemeinbesitz befindlichen Innenraum angeordnet sind. Ursprünglich war nur ein Zugang vorhanden. Geringe Größe, Lage am Rande von Feuchtland, aber auch von relativ trockenen Geestplatten, Seitenlage zu Verkehrswegen und abseits liegende Kirche sind weitere Kennzeichen.
Rundlinge treten vor allem im Hannoverschen Wendland, Mecklenburg, Pommern, Brandenburg, Thüringen und Sachsen mit allerdings ungleich großen und geschlossenen Verbreitungsgebieten auf. Ein Zusammenhang zwischen der Verbreitung dieses Siedlungstyps mit der mittelalterlichen deutschen Ostkolonisation (planmäßige Ansiedlungen gleichberechtigter Bauern) und auch mit dem Einfluss slawischer Volksstämme im deutsch-slawischen Grenzraum (Wenden) scheint offensichtlich. Die Erklärung der Genese ist aber umstritten. Heute geht die Tendenz dahin, im Rundling eine Modeform zeitlicher und regionaler Art zu sehen, bei der in Anlehnung an das schleswigsche Fortadorf der zentrale Dorfplatz auch als Einstellplatz für das Vieh während der Nacht diente.